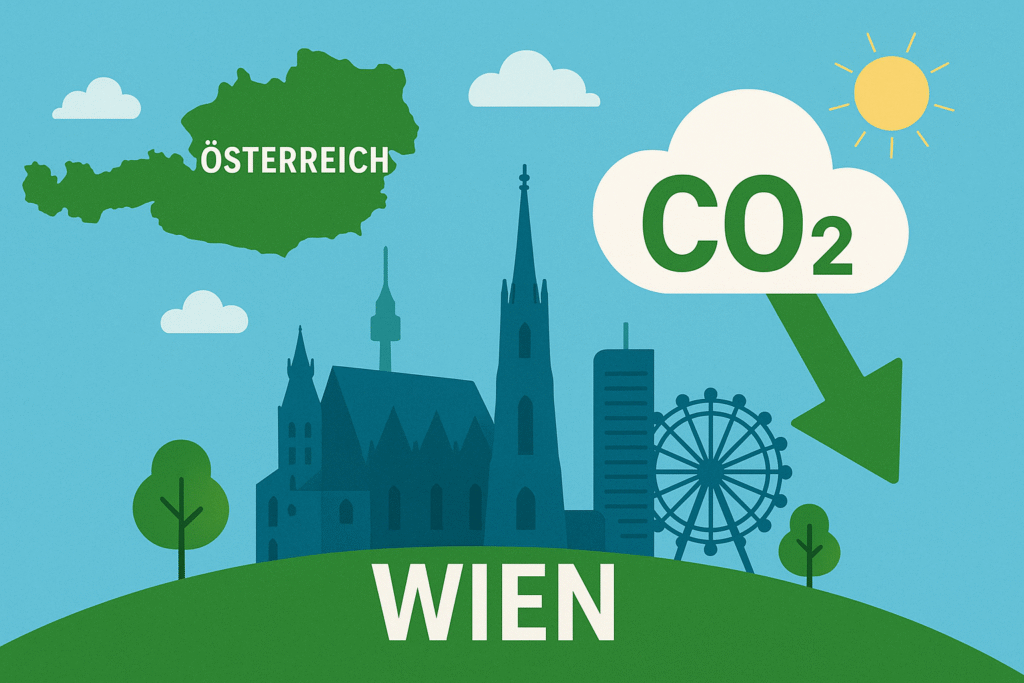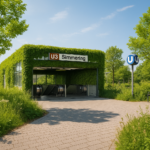Wien hat seine Treibhausgasemissionen 2024 deutlich gesenkt – und zwar schneller als der österreichische Durchschnitt. Das zeigt die Nahzeitprognose des Umweltbundesamts, kurz Nowcast, mit vorläufigen 5,8 Prozent weniger Emissionen im Vergleich zu 2023. Am 8. November 2025 wird diese Entwicklung erneut bestätigt und politisch eingeordnet. Was steckt hinter dem Vorsprung der Bundeshauptstadt? Welche Maßnahmen tragen, in welchen Sektoren gab es die größten Veränderungen, und was bedeutet das für Haushalte, Unternehmen sowie die Lebensqualität in der Stadt? Dieser Artikel ordnet die Zahlen sachlich ein, erklärt Fachbegriffe ohne Vorwissen vorauszusetzen und stellt die Entwicklung in den österreichischen und europäischen Kontext. Zudem zeigt er, wo die Reise bis 2040 hingehen muss, damit Wien das Ziel der Klimaneutralität realistisch erreicht – seriös, faktenbasiert und mit Blick auf das, was Bürgerinnen und Bürger konkret erwartet.
Wien reduziert CO2-Emissionen: Zahlen, Maßnahmen, Bedeutung
Die Kernzahl ist klar: Laut Nowcast des Umweltbundesamts sind die Treibhausgasemissionen (THG) in Wien 2024 voraussichtlich um 5,8 Prozent gesunken, während Österreich gesamt auf ein Minus von 2,6 Prozent kommt. In den Wiener Sektoren zeigt sich ein breiter Rückgang: Verkehr minus 2,6 Prozent, Gebäude minus 3,0 Prozent, Energie minus 14,3 Prozent, Industrie minus 0,8 Prozent, Abfallwirtschaft minus 1,0 Prozent, F-Gase minus 5,4 Prozent. Einzig die Landwirtschaft verzeichnet ein leichtes Plus von 1,0 Prozent, begründet durch höhere Mineraldüngermengen. Diese Werte stammen aus der Presseaussendung der Stadt Wien (Quelle unten) und basieren auf den aktuellsten verfügbaren Prognosedaten.
Politische Einordnung erfolgte durch Bürgermeister Michael Ludwig und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. Ludwig betont: „Wiens Klimaschutz ist eine Erfolgsgeschichte – und das schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert!“ Er verweist auf das erste Klimagesetz eines Bundeslands, das Wien im April 2025 in Kraft gesetzt hat. Czernohorszky stellt den sozialen Nutzen in den Vordergrund: „Der Rückgang von Emissionen steht für bessere Luft, bessere Gesundheit und eine hohe Lebensqualität.“ Ergänzend hebt Andreas Januskovecz, Bereichsleiter für Klimaangelegenheiten, den Anspruch hervor, Wien bis 2040 klimaneutral, klimaresilient und zirkulär zu machen.
Begriffe einfach erklärt
Nowcast (Nahzeitprognose): Nowcast bezeichnet eine Methode, mit der aktuelle Entwicklungen so zeitnah wie möglich quantifiziert werden, obwohl vollständige Jahresdaten noch nicht endgültig vorliegen. Behörden wie das Umweltbundesamt nutzen dafür laufend verfügbare Indikatoren, etwa Brennstoffverbräuche, Verkehrsdaten, Strommix, Witterungsinformationen und Produktionskennzahlen. Der Vorteil: Politische und betriebliche Entscheidungen können auf Basis frischer Tendenzen getroffen werden, statt ein Jahr auf die endgültige Statistik zu warten. Der Nachteil: Nowcasts werden später oft leicht nachjustiert, wenn vollständige Datensätze vorliegen. Dennoch gelten sie als robuste Orientierung für kurzfristige Entwicklungen.
Treibhausgasemissionen: Treibhausgasemissionen umfassen Gase wie Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O) und fluorierte Gase, die in der Atmosphäre Wärme festhalten. Dadurch verstärken sie den Treibhauseffekt und tragen zur Erderwärmung bei. Im Klimaschutzkontext werden Emissionen meist in CO2-Äquivalenten angegeben, damit unterschiedliche Gase mit verschiedener Wirksamkeit vergleichbar werden. Quellen sind Verkehr, Gebäudeheizungen, Industrieprozesse, Energieerzeugung, Abfallwirtschaft und Landwirtschaft. Eine Reduktion der Emissionen bedeutet konkret, dass weniger fossile Energieträger verbrannt, Prozesse effizienter gestaltet und klimafreundliche Alternativen ausgebaut werden.
Klimaneutralität: Klimaneutralität beschreibt einen Zustand, in dem verursachte Treibhausgasemissionen durch Einsparungen, Effizienz, erneuerbare Energien und verbleibende Ausgleichsmaßnahmen (etwa natürliche Senken) so weit minimiert werden, dass unterm Strich keine zusätzliche Erwärmung ausgelöst wird. Klimaneutralität ist nicht gleich Null-Emissionen, denn manche Restemissionen bleiben – etwa in industriellen Prozessen oder Landwirtschaft. Entscheidend ist, dass diese Restemissionen durch dauerhafte Senken kompensiert werden. Für Wien bedeutet Klimaneutralität bis 2040, dass Stadtverwaltung, Unternehmen und Privathaushalte gemeinsam auf einen stark dekarbonisierten Alltag umstellen.
Dekarbonisierung: Dekarbonisierung ist der systematische Ausstieg aus fossilen Kohlenstoffträgern wie Erdöl, Erdgas und Kohle. Praktisch heißt das: Umstieg auf erneuerbare Energien, elektrifizierte Mobilität, Wärmepumpen statt Gasheizungen, thermische Sanierungen und effiziente Prozesse in Industrie und Gewerbe. Dekarbonisierung ist nicht nur Technik, sondern auch Regulierung, Finanzierung, Beratung und Qualifikation. In Städten wie Wien spielt außerdem die Fernwärme eine Schlüsselrolle, weil sie zentrale Effizienzgewinne erlaubt und erneuerbare Quellen integrieren kann. Je breiter die Maßnahmen greifen, desto schneller sinken die Emissionen in allen Sektoren.
Kreislaufwirtschaft: Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, Rohstoffe möglichst lange im Umlauf zu halten. Produkte werden repariert, wiederverwendet, recycelt oder in neue Produkte überführt. Dadurch sinkt der Bedarf an Primärrohstoffen, die Abfallmengen gehen zurück, und Energieverbräuche für die Herstellung werden reduziert. In Wien zählen zu den Bausteinen der Kreislaufwirtschaft die Mistplätze, der 48er-Tandler, Repaircafés und der Wiener Reparaturbon. Für Haushalte bedeutet das: Längere Nutzungsdauer, leichtere Reparatur und oft geringere Kosten über den Lebenszyklus. Für Unternehmen entstehen neue Geschäftsmodelle rund um Service, Sharing und Rücknahme.
F-Gase (fluorierte Gase): F-Gase sind künstlich hergestellte Treibhausgase, die vor allem in Kälte- und Klimatechnik, bestimmten Industrieprozessen und in Schäumen zum Einsatz kommen. Sie haben oft ein sehr hohes Treibhauspotenzial (GWP), können also im Vergleich zu CO2 stark zur Erwärmung beitragen. Der Rückgang von F-Gasen erfordert technische Umstellungen auf alternative Kältemittel, Dichtheitsprüfungen, fachgerechte Wartung und den geordneten Rückbau alter Anlagen. Für Wien zeigt der Nowcast 2024 ein Minus von 5,4 Prozent in diesem Bereich – ein Hinweis, dass Substitution, Wartung und Rückgewinnung Wirkung zeigen.
Zirkularitätsfaktor: Der Zirkularitätsfaktor ist eine praxisorientierte Bewertungsmethode, die aufzeigt, in welchem Ausmaß Bauprojekte und Materialien in einen Kreislauf eingebunden sind. Er betrachtet unter anderem Wiederverwendbarkeit, Recyclingfähigkeit, Schadstofffreiheit sowie modulare Bauweisen. Je höher der Zirkularitätsfaktor, desto besser lassen sich Baukomponenten später trennen, aufbereiten und wieder einsetzen. Das spart Ressourcen, verringert Abfälle und reduziert Emissionen entlang des Lebenszyklus eines Gebäudes. Wien hat diesen Ansatz für zirkuläres Bauen entwickelt, um Investitionen in Richtung nachhaltiger Materialkreisläufe zu lenken.
Schwammstadt: Das Schwammstadt-Prinzip beschreibt eine städtische Gestaltung, die Regenwasser lokal aufnimmt, speichert und wieder abgibt. Versickerungsflächen, entsiegelte Bereiche, Bäume mit größeren Wurzelräumen und wasserspeichernde Substrate helfen, Hitze zu mildern, Starkregen zu puffern und die Vegetation zu stärken. In Wien tragen solche Maßnahmen zur Klimaresilienz bei: Sie kühlen Quartiere, verringern die Belastung der Kanalisation und verbessern die Aufenthaltsqualität. Für Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet das im Sommer spürbar angenehmere Temperaturen und einen robusteren Umgang mit Wetterextremen.
Klimabudget: Ein Klimabudget ist ein Steuerungsinstrument, das klimarelevante Vorhaben im öffentlichen Haushalt sichtbar macht und mit Zielen verknüpft. Es beantwortet die Frage, wie viel der öffentliche Sektor in Maßnahmen investiert, die Emissionen senken oder Anpassung fördern. Gleichzeitig lassen sich Zielpfade messen und nachsteuern. Wien hat ein solches Klimabudget als Prozess entwickelt, um wirksame Projekte im Voranschlag zu verankern. Der Nutzen: Mehr Transparenz, bessere Priorisierung und eine verbindliche Ausrichtung auf Klimaneutralität.
Klimaresilienz: Klimaresilienz bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, mit den Folgen des Klimawandels umzugehen, Schäden zu minimieren und sich rasch zu erholen. In der Stadtpraxis umfasst das Hitzeschutzpläne, Coole Zonen, Frühwarnsysteme, robuste Infrastrukturen und grüne Freiräume. Resilienz ist die zweite Säule neben Emissionsreduktion: Selbst bei erfolgreicher Dekarbonisierung treten Extremwetter häufiger auf. Wien investiert daher in Renaturierungen, Beschattung, Trinkbrunnen, Hitzeaktionspläne und eine zukunftsfähige Wasserwirtschaft, um die Gesundheit der Bevölkerung und die Funktionsfähigkeit der Stadt zu sichern.
Historischer Kontext: Wiens Klimapolitik seit den 1990ern
Der heutige Vorsprung Wiens baut auf einer langen Entwicklung auf. Bereits in den 1990er-Jahren begann die Stadt, Energieeffizienz und den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel als klimapolitische Grundpfeiler zu verankern. Der kontinuierliche Ausbau von U-Bahn, Straßenbahn und S-Bahn-Knoten, kombiniert mit dichter Siedlungsentwicklung, hat die Abhängigkeit vom Pkw reduziert. Parallel setzte Wien früh auf Fernwärme und -kälte als zentralen Hebel der Dekarbonisierung in der dichten Stadt. Diese Weichenstellungen wirkten über Jahrzehnte.
In den 2010er-Jahren rückte Klimaschutz stärker ins Zentrum der Stadtentwicklung: Sanierungsprogramme, striktere Standards im Neubau und Programme zur Flächengestaltung wurden ausgebaut. Spätestens mit dem Wiener Klimafahrplan (seit 2022) hat die Stadt eine Umsetzungsstrategie vorgelegt, die konkrete Handlungsfelder mit Projekten hinterlegt. 2023 folgten klimarelevante Anpassungen der Bauordnung, um etwa Begrünungen, Solaranlagen und Dekarbonisierung von Heizsystemen zu erleichtern. Ein wesentlicher Meilenstein ist das Wiener Klimagesetz, das seit April 2025 in Kraft ist und den rechtlichen Rahmen schärft.
Die Bilanz spricht für Kontinuität: Schon 2023 hatte Wien im Vergleich zu 2022 doppelt so viele Emissionen reduziert wie Österreich insgesamt. 2024 setzt sich dieser Trend mit 5,8 Prozent Minus fort. Diese Kontinuität ist zentral, weil Klimaschutz ein Marathon ist: Einzelne Sondereffekte (Witterung, Energiepreise) können Ausschläge verursachen, doch dauerhaft erfolgreich wird eine Stadt nur mit stabilen Strukturen, klaren Budgets und verlässlichen Anreizen für Privathaushalte und Unternehmen.
Vergleich: Andere Bundesländer und der Blick nach Deutschland und in die Schweiz
In Österreich unterscheiden sich die Rahmenbedingungen je nach Bundesland: Dichte, Wirtschaftsstruktur, Anteil ländlicher Räume und verfügbares Verkehrsangebot prägen die Klimapfade. Wien hat Vorteile einer kompakten Metropole: kürzere Wege, hoher Anteil an öffentlichem Verkehr, große Potenziale bei Fernwärme und Sanierungen im Bestand. Ländlich geprägte Regionen wiederum punkten bei erneuerbarer Stromerzeugung aus Wind, Wasser und Photovoltaik sowie bei dezentralen Gebäudelösungen. Das macht die Emissionsreduktion je nach Sektor unterschiedlich anspruchsvoll. Der Vergleich zeigt: Ein einheitlicher Maßstab greift zu kurz; sinnvoller ist ein sektorspezifischer Blick, der lokale Stärken nutzt.
Deutschland liefert ein Beispiel für sektorale Zielsteuerung: Das Bundes-Klimaschutzgesetz legt Emissionsbudgets für Sektoren fest und verpflichtet zur Nachsteuerung bei Zielverfehlung. Kontroversen um Zuständigkeiten und Flexibilisierung zeigen, wie schwierig die Verteilung von Minderungsbeiträgen ist, aber auch, wie wichtig klare Verantwortlichkeiten bleiben. Großstädte wie Berlin, Hamburg oder München verfolgen ähnliche Hebel wie Wien: Ausbau von ÖPNV, Radverkehr, Wärmewende, Sanierung. Die Erfahrungen deuten darauf hin, dass integrierte Stadtentwicklung plus soziale Abfederung die Akzeptanz stärkt.
Die Schweiz setzt stark auf direkte Demokratie und langfristige Stabilität. Mit dem 2023 angenommenen Klima- und Innovationsgesetz ist Netto-Null bis 2050 das Ziel. Städte wie Zürich und Basel treiben Gebäudesanierung, Fernwärme und erneuerbare Energien voran und kombinieren das mit hoher Lebensqualität im urbanen Raum. Für Wien ist der Blick in die Schweiz interessant, weil dort Resilienz, Wasser- und Grünraummanagement seit Jahren als Teil der Daseinsvorsorge verstanden werden. Die Lehre: Dekarbonisierung und Anpassung sind keine Gegensätze, sondern zwei Seiten derselben Strategie.
Was bedeutet der Rückgang für Bürgerinnen und Bürger?
Ein Minus von 5,8 Prozent klingt abstrakt, hat aber konkrete Folgen im Alltag. Sauberere Luft bedeutet weniger Belastung durch Schadstoffe und damit langfristig bessere Gesundheit. Wer in der Nähe stark befahrener Straßen wohnt, spürt Verbesserungen durch Verkehrsberuhigung, Radwegausbau und modernisierte Öffi-Angebote. Die größte absolute Minderung verzeichnet Wien im Verkehr: minus 2,6 Prozent. Beispiele sind neue Straßenbahnlinien, die U5 in Bau sowie die Erweiterung der U2. Auch die Kurzparkzonen-Regelung und das Zonenmodell für Stellplätze lenken den Verkehr.
Im Gebäudebereich (minus 3,0 Prozent) wirken Sanierungen, bessere Dämmung, der Heizungstausch und das Programm Raus aus Gas. Für Haushalte sinken mittelfristig die Energiekosten, weil gut sanierte Wohnungen weniger Heizbedarf haben und moderne Systeme effizient sind. Förderungen und Beratungen senken die Einstiegshürden. Wichtig ist: Soziale Abfederung und niederschwellige Information sorgen dafür, dass Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer den Umbau mittragen können.
Die Energieerzeugung weist mit minus 14,3 Prozent den stärksten prozentualen Rückgang auf. Der Mix aus Photovoltaik-Ausbau, Investitionen in erneuerbare Fernwärme und Effizienz in der Abfall- und Abwasserwirtschaft zeigt Wirkung. Wien Energie investiert in grüne Strom- und Wärmeerzeugung in und um Wien. Projekte wie die energiepositive Kläranlage der ebswien demonstrieren, wie Infrastruktur doppelt nützt: als Entsorgungsdienst und als Produzent erneuerbarer Energie. Das senkt Emissionen und stabilisiert langfristig die Versorgung.
In der Abfallwirtschaft (minus 1,0 Prozent) und bei F-Gasen (minus 5,4 Prozent) greifen technische Verbesserungen und die Kreislaufwirtschaft. Repaircafés, der 48er-Tandler und der Reparaturbon erleichtern Bürgerinnen und Bürgern, Produkte länger zu nutzen. Das ist alltagstauglicher Klimaschutz, der zugleich Kosten spart. In der Landwirtschaft, die in Wien mengenmäßig klein ist, führt die erhöhte Mineraldüngernutzung 2024 zu einem Plus von 1,0 Prozent – ein Hinweis darauf, dass auch klein wirkende Stellschrauben messbare Effekte haben.
Zahlen & Fakten: Einordnung der Sektortrends
Die Breite der Reduktionen ist bemerkenswert: Bis auf die Landwirtschaft sinken in allen Sektoren die Emissionen. Dass der Verkehrssektor die größte absolute Minderung bringt, ist schlüssig: Hier liegen traditionell hohe Emissionsmengen, und Verschiebungen bei Mobilität, Antrieb und Verkehrsorganisation wirken sich stark aus. Die minus 3,0 Prozent im Gebäudesektor deuten auf Fortschritte bei Sanierung und Wärmewende hin. Das Energie-Minus von 14,3 Prozent ist außergewöhnlich deutlich und spiegelt die Dynamik bei Sonnenstrom und Fernwärme wider, aber auch mögliche kurzfristige Faktoren wie Witterung und Brennstoffpreise, die Nowcasts naturgemäß mit abbilden. Industrie (minus 0,8 Prozent) zeigt ein kleines, aber wichtiges Minus – dort wirken Effizienz, Elektrifizierung und Förderungen.
Die Zahlen sind als Tendenz zu verstehen. Nowcasts werden in den Folgemonaten mit endgültigen Jahresdaten abgeglichen. Erfahrungsgemäß bleiben die Richtungen jedoch stabil. Für die politische Steuerung bedeutet das: Maßnahmen, die 2023 und 2024 Wirkung gezeigt haben, sollten konsequent weitergeführt und in Engpassbereichen gezielt verstärkt werden – insbesondere bei Sanierungstempo, Heizungstausch und dem Ausbau erneuerbarer Wärme.
Maßnahmen-Portfolio: Was Wien in den letzten fünf Jahren umgesetzt hat
Die Stadt verweist auf eine ganze Reihe von Projekten, die den Rückgang begünstigen. Bei der Mobilität stehen der Ausbau von U2 und Bau der U5, neue bzw. modernisierte Straßenbahnlinien (12, 18, 27) und Bahninfrastruktur im Fokus. Zusätzlich wurde die größte Radwegoffensive der Stadtgeschichte mit 130 Millionen Euro (2021–2025) umgesetzt. Ein flächendeckendes Kurzparkzonensystem und ein Zonenmodell für Stellplätze steuern den ruhenden Verkehr.
Im Gebäudebereich greift die Novelle der Wiener Bauordnung 2023 mit klimarelevanten Inhalten, unterstützt von der Sanierungs- und Dekarbonisierungsverordnung mit höher dotierten Förderungen für thermische Sanierungen und Heizungstausch. Das Programm Raus aus Gas verbessert die Rahmenbedingungen für den Umstieg auf erneuerbare Wärme. Ziel ist, die Wärmeerzeugung zügig zu dekarbonisieren und so einen großen Emissionsblock dauerhaft zu reduzieren.
Die Abfallwirtschaft setzt mit dem Plan 2025–2030, der erneuerbaren Strom- und Fernwärmeerzeugung aus Abfall- und Abwasserströmen sowie dem Projekt E_OS, das zu einer energiepositiven Kläranlage führt, wichtige Akzente. In überregionalen Aspekten rund um Kreislaufwirtschaft sticht der DoTank Circular City Wien 2020–2030 hervor, inklusive des Zirkularitätsfaktors. Strategien wie ‚Zirkuläres Wien – eine runde Sache‘ zielen auf Ressourcenschonung in der gebauten Umwelt.
Im Produktionssektor unterstützen Förderungen die Dekarbonisierung, flankiert von Beratungsprogrammen wie OekoBusiness Wien, SolarFit!, Energieeffizienz-Checks und Initiativen für erneuerbare Energien. Die Wirtschafts- und Innovationsstrategie Wien 2030 verankert Klima als Spitzenthema – ein Signal an Unternehmen, Innovation zur Emissionsminderung zu nutzen.
Für Strom- und Fernwärme nennt die Stadt die nahezu verfünffachte installierte Leistung seit Start der Sonnenstrom-Offensive sowie ein auf 15 Millionen Euro pro Jahr erhöhtes Förderbudget für Photovoltaik und Speicher. Wien Energie investiert Milliarden in erneuerbare Strom-, Fernwärme- und Grüngaserzeugung. Das stärkt die Versorgungssicherheit und reduziert Emissionen bei Strom- und Wärmenachfrage.
Zum Gesundheitsschutz gehören der optimierte Hitzewellen-Warndienst, der Wiener Hitzeaktionsplan und 22 Coole Zonen als konsumfreie, kühle Orte. Ökosysteme werden mit Renaturierungen am Wienfluss und Liesingbach gestärkt; das 90 Hektar große Schutzgebiet am ehemaligen Verschiebebahnhof Breitenlee fördert Biodiversität. Aktionen wie der ‚Wald der jungen Wienerinnen und Wiener‘ verbinden Bewusstseinsbildung mit konkretem Zuwachs an Bäumen und Sträuchern.
In der Stadtentwicklung verankert der Wien-Plan 2035 Klima-Schwerpunkte; Klimachecks für Bauvorhaben sowie für Gesetze und Verordnungen sind als neue Instrumente etabliert. Klimasensible, naturnahe Parkanlagen werden zur Regel in neuen Stadtgebieten. Der öffentliche Raum profitiert durch das Programm ‚Lebenswerte Klimamusterstadt‘ mit rund 100 Millionen Euro für 344 Projekte: Entsiegelung, neue Grünflächen (über 556.500 m²) und Begrünungen nach Schwammstadt-Prinzipien.
Bei Infrastrukturen werden Wasserversorgung und Kanalnetz modernisiert und erweitert; lokale Versickerung ist rechtlich verankert, Überflutungs- und Gewässerschutz verbessert. Auf der Ebene der Steuerung setzt Wien auf Klimagesetz (seit April 2025), Klimabudget und eine zentrale Bereichsleitung für Klimaangelegenheiten.
Analyse: Warum der Mix zählt
Die Wiener Entwicklung legt nahe, dass kein Einzelinstrument den Ausschlag gibt. Vielmehr entsteht Wirkung durch einen Mix aus Infrastruktur (Öffi, Fernwärme, Photovoltaik), Regulierung (Bauordnung, Klimagesetz), Finanzierungsanreizen (Förderungen, Klimabudget), Beratung (OekoBusiness, SolarFit!) und Bewusstseinsbildung (Hitzeaktionsplan, Coole Zonen). Gerade in einer Großstadt müssen Maßnahmen ineinandergreifen: Wenn die U-Bahn kommt, steigen die Chancen, dass neue Quartiere autoarm funktionieren. Wenn Sanierungsförderungen attraktiv sind, steigen Eigentümerinnen und Eigentümer schneller um. Wenn die Fernwärme erneuerbarer wird, verbessert sich der Fußabdruck vieler Gebäude auf einen Schlag.
Hinzu kommt die soziale Dimension: Klimapolitik ist laut Czernohorszky soziale Politik. Das bedeutet, dass Maßnahmen leistbar, verlässlich und nutzerfreundlich sein müssen. Die Kombination aus Förderungen, klaren Regeln und guter öffentlicher Infrastruktur senkt Hürden und erhöht die Akzeptanz – ein entscheidender Erfolgsfaktor für dauerhafte Emissionsminderungen.
Ausblick bis 2040: Pfad zur Klimaneutralität
Die aktuelle Reduktion ist ein Zwischenschritt. Um Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, sind drei Hebel zentral: Erstens muss die Wärmwende beschleunigt werden. Das bedeutet mehr Sanierungen pro Jahr, schnellere Umrüstung auf erneuerbare Wärme (Wärmepumpen, Fernwärme, Geothermie) und ein gezielter Fokus auf schwierige Gebäudeklassen. Zweitens braucht es eine Mobilitätswende, die über den Öffi- und Radwegausbau hinausgeht: Stadtlogistik, Sharing-Angebote, sichere Fußwege, Parkraumbewirtschaftung und intelligente Verkehrssteuerung. Drittens ist die Strom- und Wärmeerzeugung weiter zu transformieren: Photovoltaik auf Dächern und Fassaden, Speicherlösungen, Power-to-Heat und die Integration industrieller Abwärme in die Fernwärme.
Ergänzend bleibt Kreislaufwirtschaft ein Wachstumsthema. Je kreislauffähiger gebaut und produziert wird, desto geringer fallen Rohstoff- und Energieverbräuche aus. Gerade bei Bau und Sanierung kann der Zirkularitätsfaktor helfen, Ressourcen effizient zu steuern. Resilienzmaßnahmen – von der Schwammstadt bis zu Coolen Zonen – sichern die Lebensqualität in Hitzeperioden, die trotz Emissionsminderungen häufiger auftreten. Die politische Steuerung durch Klimagesetz und Klimabudget schafft Verbindlichkeit, während Monitoring wie der Wiener Klimafahrplan Fortschritte transparent macht.
Service: Weiterführende Informationen und interne Orientierung
Die Stadt Wien dokumentiert ihre Fortschritte im Monitoring des Wiener Klimafahrplans. Für eine vertiefte Lektüre lohnt ein Blick auf Projekte, Förderungen und Strategien, die in den letzten Jahren umgesetzt wurden. Leserinnen und Leser finden hier zudem thematisch passende Hintergrundstücke auf unserer Seite.
- Quelle: Stadt Wien – Kommunikation und Medien (OTS)
- Monitoring: Wiener Klimafahrplan
- Hintergrund: Wiener Klimagesetz
- Analyse: Photovoltaik-Ausbau in Wien
- Report: Radwege-Offensive und Verkehrswende
Fazit und nächste Schritte
Wien hat 2024 seine CO2-Emissionen im Nowcast um 5,8 Prozent gesenkt und liegt damit deutlich vor dem Österreich-Schnitt von 2,6 Prozent. Die Reduktion zieht sich durch nahezu alle Sektoren, mit besonders starken Signalen in Energie, Verkehr und Gebäuden. Möglich wurde das durch den Mix aus Infrastrukturinvestitionen, klaren Regeln, Förderungen und konsequenter Umsetzung. Das Klimagesetz seit April 2025, der Klimafahrplan und das Klimabudget bilden die Leitplanken.
Für die kommenden Jahre gilt: Das Erreichte verstetigen, Sanierungstempo erhöhen, die Fernwärme weiter dekarbonisieren und Mobilität noch umfassender umbauen. Bürgerinnen und Bürger profitieren durch bessere Luft, Kühlung im Sommer, niedrigere Betriebskosten und mehr Lebensqualität. Unternehmen gewinnen Planungssicherheit und Effizienz. Haben Sie Fragen, Beispiele aus Ihrem Grätzel oder Erfahrungen mit Sanierung und Heizungstausch? Schreiben Sie uns – welche Maßnahme hat bei Ihnen den größten Unterschied gemacht? Weitere Hintergründe und Dossiers finden Sie in unseren verlinkten Beiträgen.
Quellenhinweis
Dieser Beitrag basiert auf der Presseaussendung der Stadt Wien – Kommunikation und Medien (KOM) vom 8. November 2025 sowie den darin referenzierten Nowcast-Daten des Umweltbundesamts. Alle Zahlenangaben und Projektbeispiele stammen aus der verlinkten Quelle bzw. aus den öffentlichen Informationsangeboten der Stadt Wien.