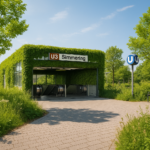Wien warnt: Fast Fashion treibt Plastikmist und Mikroplastik an – die Stadt und DIE UMWELTBERATUNG setzen auf lange Nutzung und Reparatur. Am 8. November 2025 steht fest: Der schnelle Modekauf hat einen langsamen, hartnäckigen Fußabdruck. Während neue Kollektionen im Wochentakt erscheinen, füllen sich Müllöfen und ferne Deponien. Was heute bequem im Warenkorb landet, kann morgen schon als Mikroplastik in Luft und Wasser schweben. Österreichs Hauptstadt adressiert dieses Problem direkt – mit Information, konkreten Angeboten und klaren Empfehlungen, die Konsumentinnen und Konsumenten sofort umsetzen können.
Fast Fashion in Wien: Ursachen, Folgen und nachhaltige Alternativen
Die aktuelle Aussendung der Stadt Wien (Quelle: Stadt Wien – Kommunikation und Medien, OTS) macht unmissverständlich deutlich: Kunstfasern dominieren den Textilmarkt, und Recyclingpolyester ist keine umfassende Lösung. Der Großteil unserer Kleidung wird nach kurzer Nutzung entsorgt, weil das Textilrecycling technisch aufwendig, wirtschaftlich schwierig und logistisch hinter dem Verbrauch zurückliegt. Die zentrale Botschaft: Textilien länger verwenden, gezielt pflegen und Secondhand-Angebote nutzen – das ist ökologisch und für viele Haushalte finanziell vernünftig.
Die Expertinnen und Experten von DIE UMWELTBERATUNG empfehlen daher reduzierten Konsum, hochwertige Qualität und möglichst wenig Kunstfaser im Kleiderschrank. Gleichzeitig zeigt die Stadt Wien auf, wo Bürgerinnen und Bürger verlässliche Informationen und Services finden, von der Hotline bis zu Workshops. Ergänzend lohnt sich ein Blick in thematisch verwandte Dossiers und Analysen, etwa zu Kreislaufwirtschaft und Secondhand, zu Mikroplastik im Alltag und zu nachhaltiger Mode in Österreich.
Fachbegriff erklärt: Fast Fashion
Fast Fashion bezeichnet ein Geschäftsmodell, bei dem Mode sehr schnell von Trends und Laufstegen in Filialen und Online-Shops gelangt. Die Produktionszyklen sind kurz, die Preise niedrig, die Stückzahlen hoch. Für Laien greifbar wird das am ständigen Wechsel von Kollektionen und Aktionen, die zum häufigen Neukauf animieren. Die ökologischen Folgen resultieren aus hohem Rohstoffbedarf, intensiver Chemienutzung, langen Transportwegen und großen Restmengen. Wird ein Kleidungsstück nur wenige Male getragen, stehen Aufwand und Umweltwirkung in keinem Verhältnis zum Nutzen. Genau hier setzt die Wiener Informationskampagne an: weniger kaufen, länger verwenden, besser pflegen.
Fachbegriff erklärt: Recyclingpolyester
Recyclingpolyester ist ein Kunststofffaser-Material, das aus bereits verwendetem PET hergestellt wird. Für viele klingt das nach Kreislauf, doch im Textilbereich stammt der Rohstoff häufig nicht aus Alttextilien, sondern aus Einwegflaschen. Laien hilft das Bild des Materialabstiegs: Aus einem hochwertigen Flaschen-PET entsteht ein Faserprodukt mit geringeren Qualitätsanforderungen. Das spart unter Umständen zwar Rohöl, löst aber die Frage der Textilabfälle nicht. Zudem bleiben die Faser-Mikroplastikemissionen beim Tragen und Waschen bestehen. Die Stadt Wien weist daher darauf hin, dass Recyclingpolyester kein Freifahrtschein ist, sondern nur in Kombination mit langlebiger Nutzung sinnvoll sein kann.
Fachbegriff erklärt: Mikroplastik
Mikroplastik sind winzige Kunststoffpartikel, die kleiner als fünf Millimeter sind. Sie entstehen unter anderem beim Abrieb und Waschen synthetischer Textilien wie Polyester oder Polyamid. Für Laien anschaulich: Jeder Waschgang kann feinste Fasern freisetzen, die Kläranlagen nur teilweise zurückhalten. Ein Teil gelangt in Gewässer und Böden, ein anderer Teil in die Innenraumluft – und damit auch in unsere Atemwege und potenziell in den menschlichen Körper. Gesundheitliche und ökologische Risiken sind Gegenstand intensiver Forschung. Klar ist: Weniger synthetische Textilien und eine lange Nutzungsdauer mindern die Menge freigesetzter Partikel.
Fachbegriff erklärt: Downcycling
Downcycling meint die Umwandlung eines Materials in ein Produkt von geringerer Qualität oder Funktionalität. Während echtes Recycling den Stoffkreislauf möglichst auf gleichbleibendem Niveau hält, verschlechtert sich beim Downcycling die Materialklasse. Im Kontext von Textilien bedeutet das: Aus einer hochwertigen PET-Flasche entsteht eine Faser, die sich später nur schwer wieder zu gleicher Flaschenqualität verarbeiten lässt. Für Laien heißt das: Der Kreislauf wird nicht geschlossen, sondern abgestuft. Ökologisch sinnvoller ist es, hochwertige Materialien in ihrem Qualitätssegment zu halten, also Flaschen wieder zu Flaschen zu machen oder im Mehrwegsystem zu verwenden.
Fachbegriff erklärt: PFAS
PFAS sind per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, eine große Gruppe sehr stabiler Chemikalien, die Wasser, Fett und Schmutz abweisen. Sie werden häufig in der Imprägnierung von Outdoor-Textilien eingesetzt. Für Laien erklärt: PFAS sind extrem langlebig und bauen sich in der Umwelt kaum ab, weshalb man sie auch Ewigkeitschemikalien nennt. Einige Vertreter stehen im Verdacht, gesundheitlich problematisch zu sein. Deshalb gewinnt die Suche nach PFAS-freien Alternativen an Bedeutung. Naturfasern wie Wolle oder dicht gewebte Baumwolle können unter geeigneten Bedingungen Outdoor-Funktionen erfüllen, ohne auf persistente Chemikalien zu setzen.
Fachbegriff erklärt: Thermische Verwertung
Thermische Verwertung bedeutet, dass Abfälle verbrannt und die dabei entstehende Energie genutzt werden. Für viele klingt das nach sauberer Lösung, doch aus Ressourcensicht gehen dabei wertvolle Materialien endgültig verloren. Für Laien ist der Unterschied wichtig: Verwertung ist nicht gleich Recycling. Wird Textilmaterial verbrannt, kehrt es nicht als Faser zurück. Deshalb betont die Wiener Aussendung, dass die thermische Verwertung den Kleidungsberg nicht kleiner macht. Sie ist eher das Ende einer Kette, die idealerweise mit langlebigem Design, sorgfältiger Nutzung, Reparatur und Wiederverwendung deutlich verlängert werden soll.
Fachbegriff erklärt: Kreislaufwirtschaft
Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, Produkte, Komponenten und Materialien möglichst lange im Umlauf zu halten. Für Laien lässt sich das als Verlängerung der Lebensdauer und als Wiederverwendung erklären, bevor an Recycling gedacht wird. Bei Textilien bedeutet das: robuste Kleidung kaufen, reparieren, weitergeben, tauschen oder verkaufen und erst am Ende recyceln. Ein funktionierender Kreislauf braucht aber gut organisierte Sammlung, sortenreine Trennung, moderne Aufbereitung und wirtschaftliche Anreize. Wien verweist dazu auf Informationsangebote und gute Praxis, etwa Secondhand-Märkte und Reparatur-Workshops.
Historischer Kontext: Vom Siegeszug der Kunstfasern zur Wegwerf-Mode
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts prägen synthetische Fasern wie Nylon und Polyester den Modemarkt. Sie sind günstig, formstabil, pflegeleicht und in riesigen Mengen verfügbar. Mit der Globalisierung der Produktion, der Just-in-Time-Logistik und dem Aufstieg des Onlinehandels beschleunigte sich das Tempo weiter. In den 1990er- und 2000er-Jahren etablierten sich Fast-Fashion-Ketten und digitale Plattformen, die Kollektionen binnen Wochen austauschen. Die Folge: Kleidung verlor an wahrgenommenem Wert. Hemden, Hosen und Kleider werden öfter gekauft, seltener getragen und rascher entsorgt.
Die Presseinformation der Stadt Wien verweist auf einen zentralen Kipppunkt: Der Umgang mit Retouren im Onlinehandel befeuert den Verbrauch zusätzlich. Je nach Anbieterfirma liegt die Retourenquote durchschnittlich zwischen 26 und 50 Prozent (Quelle: BTE Handelsverband Textil 2023). Rücksendungen werden nicht automatisch wiederverkauft; bis zu 24 Prozent landen ungetragen im Abfall. Das ist die logistische Schattenseite der grenzenlosen Auswahl. Während Konsumentinnen und Konsumenten bequem zu Hause probieren, entstehen an anderer Stelle Kosten, Emissionen und Abfallmengen.
Parallel blieb die Recycling-Infrastruktur für Textilien hinter der Dynamik des Marktes zurück. Faser-Mischungen, Veredelungen, Reißverschlüsse, Knöpfe und Drucke erschweren eine sortenreine Trennung. Viele Stücke werden thermisch verwertet; ein Teil landet auf Deponien oder in entlegenen Ablagerungen – exemplarisch genannt wird die chilenische Atacama-Wüste. In Summe entsteht ein Bild: Der technische Fortschritt der schnellen Mode hängt in Sachen Kreislauf hinterher. Daher betonen Wiener Stellen das Naheliegende: Verlängerte Nutzung ist aktuell die wirksamste Maßnahme.
Vergleich: Österreich, Deutschland und die Schweiz im Blick
Österreich setzt in der Abfallwirtschaft traditionell stark auf getrennte Sammlung, Aufklärung und kommunale Dienstleistungen. In Wien kommen Sammlungen, Charity-Shops und Angebote wie der 48er-Tandler zusammen. Der Fokus liegt auf Vermeidung, Wiederverwendung und einem verantwortungsvollen Einkauf im öffentlichen Bereich, auf den die Stadt über Ökokauf Wien verweist. Gleichzeitig stehen die Herausforderungen der Textilflut im Raum: hohe Rücklaufmengen, gemischte Qualitäten und begrenzte Recyclingkapazitäten.
Deutschland diskutiert ähnliche Fragen. Aus dem Onlinehandel sind hohe Retourenquoten bekannt; Initiativen für nachhaltige Lieferketten, bessere Produkttransparenz und Design-for-Recycling nehmen zu. Freiwillige Bündnisse und Unternehmensverpflichtungen sollen Schritte nach vorne bringen, doch die schiere Masse des Marktes bleibt eine Hürde. Die Schweiz fällt durch eine lange Tradition der Sammlung und eine starke Secondhand-Kultur auf. Qualität, Reparatur und Wiederverkauf spielen eine große Rolle; das unterstützt eine längere Produktnutzung. Allerdings sind auch dort synthetische Fasern weit verbreitet, und textile Mischungen erschweren das Recycling.
Auf EU-Ebene ist der Weg vorgezeichnet: Bis 2025 sollen Mitgliedstaaten eine separate Sammlung für Textilien einrichten. Das bedeutet für Österreich, Deutschland und die Schweiz (als Nicht-EU-Land mit eigener Regulierung) unterschiedliche Geschwindigkeiten, aber ein gemeinsames Ziel: bessere Sortierung, mehr Wiederverwendung, klarere Verantwortung entlang der Lieferkette. In allen drei Ländern wird die Verbraucherinformation entscheidend sein, damit gute Systeme auch genutzt werden – von der korrekten Abgabe über Secondhand bis zur Reparatur.
Was bedeutet das für Bürgerinnen und Bürger in Österreich?
Die Auswirkungen sind konkret spürbar. Wer oft synthetische Kleidung wäscht, trägt zur Mikroplastik-Last in Luft und Wasser bei. Jeder Waschgang kann winzige Fasern freisetzen. Ein Umstieg auf langlebige Naturfasern, eine reduzierte Waschfrequenz nach Bedarf und eine schonende Pflege helfen, Emissionen zu senken. Wer bei Neuanschaffungen auf Qualität statt Quantität setzt, spart auf Sicht Geld und Ressourcen. Secondhand-Käufe, Tauschbörsen und Leihmodelle verlängern die Lebensdauer von Textilien. In Wien bieten Flohmärkte, Social-Business-Läden und kommunale Initiativen eine dicht geknüpfte Infrastruktur.
Ein weiterer Punkt ist der Umgang mit Retouren. Wer vor dem Bestellen Größen, Schnitte und Materialien sorgfältig prüft und Beratungsangebote nutzt, reduziert Rücksendungen und damit verbundene Abfälle. Die Wiener Information macht deutlich: Retouren werden nicht automatisch wiederverkauft; bis zu 24 Prozent der Rückläufer landen ungetragen im Abfall. Das lässt sich durch bewusste Kaufentscheidungen mindern.
Für Familien, Studierende sowie Seniorinnen und Senioren bieten Wartung und Reparatur großes Potenzial. Ein lose gewordener Knopf, eine kleine Naht oder ein verschlissener Saum sind kein Grund für Entsorgung. DIE UMWELTBERATUNG und die Stadt Wien setzen hier mit konkreten Angeboten an. Im Rahmen der Orange Week gibt es im 48er-Tandler Margareten praktische Tipps, damit Kleidung lange in Verwendung bleibt: Der Workshop ‚Kleidung lange haltbar machen‘ findet am Dienstag, 25. November 2025 von 16 bis 19 Uhr statt. Der Workshop ‚Pflege und Reparatur von Textilien‘ folgt am Donnerstag, 27. November 2025 von 15 bis 18 Uhr. Veranstaltungsort: 48er-Tandler, Siebenbrunnenfeldgasse 3, 1050 Wien.
Zahlen und Fakten aus der Wiener Aussendung
Die Presseinformation verweist auf mehrere zentrale Punkte:
- Kunstfasern sind auf dem Vormarsch; kaum ein Textilstück ist frei davon.
- Recyclingpolyester ist noch keine nachhaltige Gesamtlösung, da als Rohstoff meist Einwegflaschen dienen und Alttextilien selten zum Einsatz kommen.
- Textilrecycling steckt in den Kinderschuhen; Sammlung und Verwertung hinken dem Verbrauch deutlich hinterher.
- Viele Kleidungsstücke werden kaum getragen und frühzeitig entsorgt.
- Je nach Anbieterfirma liegt die Retourenquote im Onlinehandel durchschnittlich zwischen 26 und 50 Prozent (Quelle: BTE Handelsverband Textil 2023).
- Rücksendungen werden nicht automatisch wiederverkauft; bis zu 24 Prozent landen ungetragen im Abfall.
- Der Großteil der Textilien wird thermisch verwertet; ein Teil landet sogar auf Freiflächen wie in der chilenischen Atacama-Wüste.
Diese Punkte zeigen, dass die größte Hebelwirkung derzeit in der Nutzungsphase liegt. Längere Tragezeiten, sachgerechte Pflege und die Nutzung von Secondhand-Angeboten können die Abfallmengen unmittelbar verringern. Die Zulieferketten und die Materialwahl bleiben wichtig, lösen kurzfristig aber nicht das Problem der vorhandenen Textilberge. Besonders deutlich ist der Widerspruch, dass Recyclingpolyester häufig aus PET-Flaschen stammt. Aus ökologischer Sicht ist es sinnvoll, hochwertige Flaschen wieder zu Flaschen zu machen oder sie im Mehrwegsystem zu führen. Das sogenannte Downcycling löst den Flaschenstrom vom Textilstrom, ohne die Textilabfälle wesentlich zu reduzieren.
Expertinnenstimme aus Wien
Die Textilexpertin Michaela Knieli von DIE UMWELTBERATUNG wird in der Aussendung mit zwei Kernaussagen zitiert. Erstens: ‚Auch wenn an vielen Textilien ein Umwelt-Label wie zum Beispiel ein Recycling-Symbol prangt, ist die Textilindustrie noch lange nicht ökologisch. Und wir kaufen einfach zu viel!‘ Zweitens verweist sie auf die Vorteile von Naturfasern im Outdoor-Bereich: Das ‚natürliche Funktionshirt‘ des Schafes – also Wolle – hat eine isolierende, wärmende Wirkung und riecht im Gegensatz zu Polyester weniger nach Schweiß. Diese Hinweise sind praxisnah und helfen bei alltäglichen Entscheidungen.
Praktische Tipps: So handeln Haushalte in Wien heute
- Bewusst einkaufen: wenige, qualitativ hochwertige Stücke anschaffen.
- Kunstfaseranteil verringern: bevorzugt Naturfasern wählen, wo Funktion und Alltag es zulassen.
- Länger nutzen: schonend waschen, lüften, kleine Schäden sofort reparieren.
- Secondhand nutzen: Flohmärkte, Tauschbörsen und soziale Kaufhäuser besuchen.
- Retouren vermeiden: Größenangaben prüfen, Bewertungen lesen, Materialeigenschaften beachten.
- Information einholen: Leitfäden und Beratungsangebote nutzen, etwa bei DIE UMWELTBERATUNG.
Weiterführende Informationen finden Sie unter umweltberatung.at/textilien. Die Stadt informiert zudem zu nachhaltigem Einkauf über Ökokauf Wien: wien.gv.at/umwelt/oekokauf-ergebnisse#textilien. Die Originalquelle der Aussendung ist hier abrufbar: OTS: Fast Fashion macht Plastikmist.
Zukunftsperspektive: Wie kommt die Wende im Textilkreislauf?
In den nächsten Jahren werden drei Entwicklungen entscheidend sein. Erstens die getrennte Sammlung von Textilien: Je besser Kleidung sortenrein erfasst und vorselektiert wird, desto höher ist das Potenzial für Wiederverwendung und hochwertiges Recycling. Zweitens das Design for Recycling: Herstellerinnen und Hersteller entwickeln robuste, reparierbare und sortenreine Produkte mit klaren Faserangaben, weniger problematischen Mischungen und ohne persistente Chemikalien wie PFAS. Drittens eine Stärkung von Secondhand, Reparatur und Mietmodellen, die den Bedarf an Neuware dämpfen.
Für Wien eröffnet das die Chance, vorhandene Stärken – Beratung, kommunale Infrastruktur, soziale Einrichtungen – zu bündeln. Workshops wie im 48er-Tandler fördern praktische Fertigkeiten, die unmittelbar wirken. Öffentliches Beschaffungswesen kann Vorbild sein: Der Hinweis auf Ökokauf Wien zeigt, dass Städte mit gutem Beispiel vorangehen können. Auf EU-Ebene wird die separate Textilsammlung den Druck auf Herstellerinnen und Hersteller erhöhen, langlebige und kreislauffähige Produkte zu gestalten. Konsumentinnen und Konsumenten profitieren davon doppelt: durch bessere Qualität im Schrank und weniger Plastik in Umwelt und Körper.
Schluss: Weniger ist mehr – und länger ist besser
Die Wiener Botschaft ist klar: Fast Fashion erzeugt Plastikmist, und die schnellste Entlastung liegt in unserer Hand. Wer weniger, dafür besser kauft und Kleidung lange nutzt, schützt Umwelt und Geldbörse. Recyclingpolyester ist kein Freibrief; entscheidend bleibt die Lebensdauer. Mikroplastik lässt sich durch bewusste Materialwahl und Pflege reduzieren. Nutzen Sie die Angebote vor Ort: die Hotline von DIE UMWELTBERATUNG unter 01 803 32 32, die Informationsseite umweltberatung.at/textilien und die Workshops im 48er-Tandler am 25. und 27. November 2025. Weitere Hintergründe und Analysen finden Sie gebündelt auf pressefeuer.at. Welche Maßnahme setzen Sie als Nächstes: Reparieren, tauschen oder Secondhand kaufen?