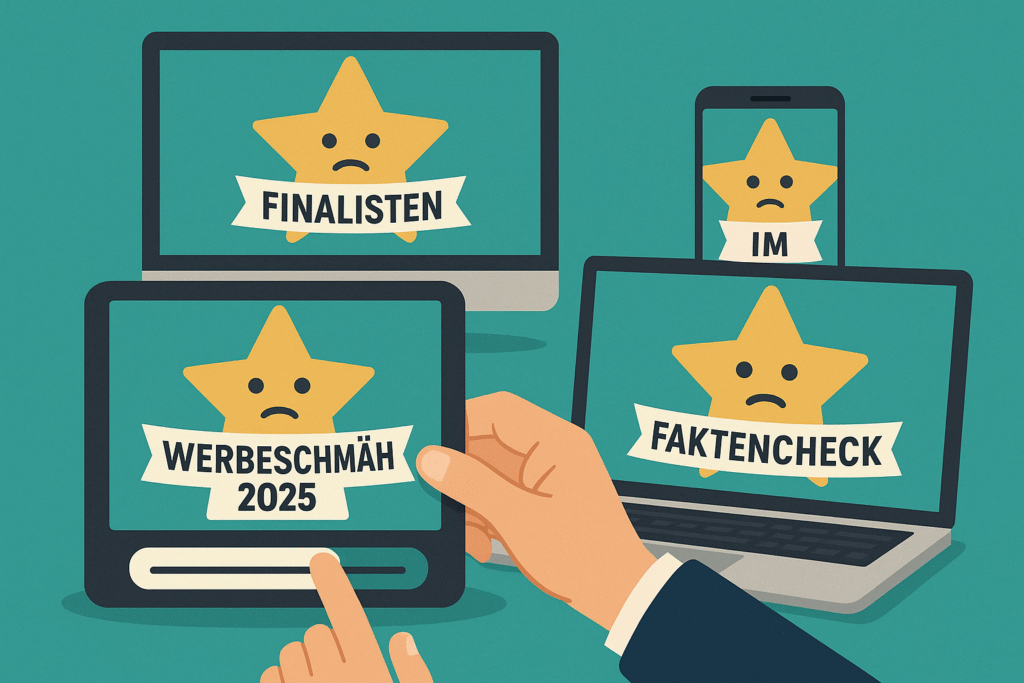Wien, 7. November 2025: Foodwatch Österreich startet die Wahl zum „Werbeschmäh des Jahres“ und rückt Mogelpackungen sowie irreführende Werbeversprechen in den Fokus. Ab sofort können Konsumentinnen und Konsumenten über fünf Produkte abstimmen, die exemplarisch für problematische Vermarktung stehen. Die Aktion ist aktuell, österreichweit relevant und lädt zur Beteiligung ein. Doch hinter der kurzen Wahlankündigung steckt eine größere Geschichte: Es geht um Transparenz, Konsumentenschutz, klare Regeln für Gesundheitsclaims – und um die Frage, wie fair unsere Supermarktregale tatsächlich sind.
Werbeschmäh des Jahres 2025: fünf Finalisten im Check
Foodwatch Österreich ruft erneut zur Wahl des „Werbeschmäh des Jahres“ auf. Die Abstimmung läuft bis 8. Dezember 2025 auf der Kampagnenseite werbeschmaeh-des-jahres.at. Grundlage dieser Berichterstattung ist die Pressemitteilung von Foodwatch e. V. (OTS-Aussendung).
Die Finalisten spiegeln typische Mechanismen wider, mit denen Image und Inhalt auseinanderdriften. Laut Foodwatch sind das heuer: eine Kakaokapsel, die pro Tasse teurer ist und Müll erzeugt; ein Energydrink-Pulver, dessen bunte Inszenierung Kinder und Jugendliche anspricht; ein geschrumpfter Keks zum alten Preis; ein Sirup, der Immunstärke suggeriert, aber hauptsächlich aus Zucker besteht; und ein Cottage Cheese, der als High-Protein-Produkt beworben wird, obwohl er im Vergleich zu günstigeren Eigenmarken teils weniger Eiweiß enthält.
Die zentrale Frage lautet: Wo endet Marketing – und wo beginnt Irreführung? Laut Foodwatch erklärt die Leiterin von Foodwatch Österreich, Indra Kley-Schöneich: „Mit dem Werbeschmäh des Jahres halten wir Unternehmen den Spiegel vor. Wir zeigen, wo Konsumentinnen und Konsumenten in die Irre geführt werden – und fordern ein Ende der manipulativen Werbeversprechen.“ Diese Kritik knüpft an europäische und nationale Regeln an, etwa an die EU-Health-Claims-Verordnung, das österreichische Wettbewerbsrecht sowie Vorschriften zu Kennzeichnung und Lebensmittelwerbung.
Die fünf Produkte im Überblick
- Dolce Gusto Nesquik: Laut Foodwatch kostet eine Portion in der Kapselvariante rund 50 Prozent mehr als eine klassisch zubereitete Tasse Nesquik. Zusätzlich entsteht Kapselmüll aus Kunststoff-Aluminium-Verbund, der schwer recycelbar ist.
- GAMERS ONLY Energydrink (Teenage Mutant Ninja Turtles-Edition): Das Pulver enthält hohe Koffeinkonzentrationen. Bunte Optik und Comic-Stil sprechen junge Zielgruppen an. Bei falscher Dosierung droht eine Überdosis.
- Lotus Biscoff: Die Packungsgröße wurde laut Foodwatch von 250 auf 200 Gramm reduziert, der Verkaufspreis blieb gleich. Das erhöht den Kilopreis um etwa 25 Prozent (Shrinkflation).
- Mautner Markhof Sirup+ Immunbooster: Der Name suggeriert eine Immunstärkung. Laut Foodwatch besteht das Produkt zu zwei Dritteln aus Zucker. Vitamin C und Zink sind zugesetzt, der Hinweis wirkt jedoch aus Sicht der NGO unzureichend prominent.
- NÖM Pro Cottage Cheese: Das Produkt wird als High-Protein-Alternative beworben. Laut Foodwatch liegt der Eiweißgehalt teils unter dem vergleichbarer, günstigere Eigenmarken.
Mehr Hintergründe finden Sie in unseren Dossiers: Kennzeichnung bei Lebensmitteln, Shrinkflation in Österreich und EU-Health-Claims-Verordnung erklärt.
Fachbegriffe verständlich erklärt
Mogelpackung
Der Begriff „Mogelpackung“ bezeichnet Produkte, deren Verpackung eine größere Menge oder höheren Wert suggeriert, als tatsächlich enthalten ist. Das kann durch überdimensionierte Kartons, dicke Böden, viel Luft im Beutel oder durch reduzierte Füllmengen bei gleichem Packungsdesign geschehen. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist das tückisch, weil Gewohnheit und Wiedererkennungswert steuern, wie wir greifen – wir orientieren uns an Form, Farbe, Platz im Regal. Wird die Füllmenge still reduziert, fällt der Unterschied ohne genaues Studium der Grammangabe oft nicht auf. Juristisch ist nicht jede Mogelpackung automatisch unzulässig. Entscheidend sind Transparenz, Irreführungsgefahr und die Gesamteindrucksbewertung, wie sie das Wettbewerbsrecht kennt.
Shrinkflation
„Shrinkflation“ setzt sich aus „shrink“ (schrumpfen) und „inflation“ zusammen. Gemeint ist das Phänomen, dass Hersteller die Füllmenge eines Produkts verringern, den Preis aber unverändert lassen. Dadurch steigt der Preis pro Einheit implizit. Für Haushalte ist Shrinkflation schwerer erkennbar als klassische Preiserhöhungen, weil die Packung ähnlich aussieht. Aus ökonomischer Sicht ist das eine Preisanpassung über die Quantität statt über den Kassenpreis. Konsumentinnen und Konsumenten können sich schützen, indem sie den Grundpreis (zum Beispiel Euro pro Kilogramm) vergleichen. In der öffentlichen Debatte gilt Shrinkflation als intransparent, wenngleich sie rechtlich nicht per se verboten ist, sofern Kennzeichnungspflichten eingehalten werden.
EU-Health-Claims-Verordnung
Die EU-Health-Claims-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1924/2006) regelt gesundheits- und nährwertbezogene Angaben auf Lebensmitteln. Vereinfacht gesagt: Wer auf eine Gesundheitswirkung hinweist, darf das nur mit wissenschaftlich abgesicherten, zugelassenen Formulierungen. „Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei“ ist eine solche zulässige Aussage. Gleichzeitig verlangt die Verordnung, dass Angaben nicht irreführend sind und im richtigen Kontext erscheinen. Für Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet das mehr Orientierung, allerdings bleibt die Bewertung des Gesamteindrucks – etwa wie dominant eine Botschaft auf der Vorderseite platziert ist – ein sensibles Thema, das Behörden und Gerichte im Einzelfall würdigen.
Kunststoff-Aluminium-Verbund und Recycling
Viele Kaffeekapseln bestehen aus Verbundmaterialien, also aus mehreren fest verbundenen Schichten (zum Beispiel Kunststoff und Aluminium). Diese Kombination erfüllt technische Zwecke, etwa Aromaschutz und Stabilität, erschwert jedoch das Recycling. Denn für eine sortenreine Wiederverwertung müssten die Schichten getrennt werden – ein aufwendiger Prozess, der in gängigen Sammel- und Sortiersystemen oft nicht vorgesehen ist. So verbleiben Verbunde im Restmüll oder werden thermisch verwertet. Für die Abfallbilanz heißt das: Ein scheinbar kleines Produkt kann, multipliziert mit Millionen Portionen, beträchtliche Abfallmengen generieren, wenn es keine effizienten Rücknahmesysteme gibt.
Energydrink und Koffeinkonzentration
Energydrinks enthalten typischerweise Koffein, Zucker oder Süßungsmittel sowie weitere Zutaten wie Taurin oder Vitamine. Bei Pulverprodukten kommt ein besonderes Risiko hinzu: Die Dosierung liegt in der Hand der Verbraucherinnen und Verbraucher. Wird zu hoch dosiert, steigt die Koffeinaufnahme schnell an. Koffein wirkt stimulierend, kann jedoch in hohen Mengen Unruhe, Schlafprobleme, Nervosität, Herzrasen oder Herzrhythmusstörungen auslösen. Für Kinder und Jugendliche empfehlen Gesundheitsfachleute generell Zurückhaltung bei koffeinhaltigen Produkten. In der Bewertung solcher Produkte kommt es deshalb auf klare Dosierhinweise, Zielgruppengestaltung und den Gesamteindruck der Verpackung an.
High-Protein-Claim und Eiweißgehalt
„High Protein“ ist ein werblicher Hinweis, der auf einen erhöhten Eiweißgehalt hindeutet. Aus ernährungsphysiologischer Sicht liefern Eiweiße Baustoffe für Muskeln, Enzyme und viele Körperfunktionen. Allerdings ist die Information nur dann nützlich, wenn sie im Kontext steht: Wie viel Protein hat das Produkt pro 100 Gramm im Vergleich zu ähnlichen Lebensmitteln? Wie hoch ist der Preis pro Gramm Eiweiß? Im Handel existieren oft günstigere Alternativen mit vergleichbarem oder höherem Proteinanteil. Für Konsumentinnen und Konsumenten lohnt sich daher der nüchterne Blick auf die Nährwerttabelle, statt sich allein von Claims leiten zu lassen.
Historischer Kontext: Vom Slogan zur Regulierung
Lebensmittelwerbung hat eine lange Geschichte. In den Nachkriegsjahrzehnten prägten Slogans und Logos die Markenbindung. Werbeversprechen standen im Zentrum – teils über pointierte Aussagen, teils über ikonische Bildwelten. Mit wachsendem Wohlstand, globalisierten Lieferketten und immer dichteren Regalen wurde Differenzierung wichtiger. Hersteller setzten stärker auf Zusatznutzen: weniger Fett, mehr Vitamine, natürliche Zutaten, bewusste Ernährung. Gleichzeitig verschärfte sich das Bedürfnis nach verlässlicher Information, befeuert von Verbraucherbewegungen und wissenschaftlichen Debatten über Zucker, Fett, Salz und Zusatzstoffe.
Europäisch mündete das in eine Reihe von Regelwerken. Ein Meilenstein ist die EU-Health-Claims-Verordnung von 2006, die seit 2007 angewendet wird. Sie verlangt, dass gesundheitsbezogene Aussagen zulässig, wissenschaftlich abgesichert und nicht irreführend sind. Parallel entwickelten sich in den Mitgliedstaaten Instrumente zur Marktaufsicht. In Österreich setzen sich neben Behörden auch Organisationen wie Foodwatch mit Kampagnen für Transparenz ein. Die Wahl zum „Werbeschmäh des Jahres“ steht in dieser Tradition – nicht als staatliche Sanktion, sondern als zivilgesellschaftischer Spiegel, der Debatten anstößt und Verbrauchersensibilität schärft.
Neuere Entwicklungen wie Shrinkflation zeigen, wie Marktmechanismen auf Kostendruck reagieren: statt expliziter Preiserhöhungen stille Mengenreduktionen. Rechtlich kommt es dann auf die korrekte Kennzeichnung und die Frage an, ob der Gesamteindruck Konsumentinnen und Konsumenten irreführen kann. Auf dieser Linie argumentiert Foodwatch, wenn Verpackungen, Claims und Produktinszenierungen Erwartungen wecken, die der Inhalt nicht einlöst.
Vergleich: Österreich, Deutschland, Schweiz
Österreich agiert im Rahmen des EU-Rechts. Gesundheitsbezogene Angaben folgen den europäischen Vorgaben, Kennzeichnungsvorschriften sollen klare Informationen bieten, und das Lauterkeitsrecht adressiert irreführende Geschäftspraktiken. In Deutschland gelten die gleichen EU-Rahmen. Zudem sind Verbraucherorganisationen wie die Verbraucherzentralen seit Jahren lautstarke Akteure, wenn es um Shrinkflation und Mogelpackungen geht. Sie dokumentieren Fälle und setzen auf Aufklärung sowie rechtliche Prüfungen im Einzelfall.
Die Schweiz steht außerhalb der EU und folgt eigenen Normen, orientiert sich aber in vielen Bereichen an internationalen Standards. Konsumentenschutzorganisationen wie die Stiftung für Konsumentenschutz thematisieren dort ebenfalls irreführende Werbung und transparente Kennzeichnung. Unterschiede ergeben sich im Detail: Zuständigkeiten der Aufsicht, Wege der Rechtsdurchsetzung und die Ausgestaltung freiwilliger Label. Gemeinsam ist allen drei Ländern die wachsende Sensibilität für Preiswahrnehmung, Gesundheitsclaims und Abfallvermeidung – Themen, die quer über Grenzen hinweg die Einkaufsentscheidungen prägen.
Konkreter Impact für Bürgerinnen und Bürger
Was bedeutet der „Werbeschmäh des Jahres“ im Alltag? Zunächst mehr Aufmerksamkeit. Wer regelmäßig im Supermarkt einkauft, entwickelt Routinen. Eine gewohnte Packung wirkt vertraut – und genau hier setzt Shrinkflation an. Wenn eine 250-Gramm-Packung plötzlich 200 Gramm enthält, der Preis gleich bleibt und Design sowie Platzierung unverändert sind, zahlen Haushalte pro Kilogramm mehr. Wer aber bewusst den Grundpreis vergleicht, erkennt die Änderung. Für Familien mit knappem Budget zählt jeder Euro – kleinere Füllmengen ohne Preisschildanpassung können in Summe eine spürbare Mehrbelastung bedeuten.
Bei Kapselsystemen treffen Komfort und Umwelt aufeinander. Eine Tasse Kakao aus einer Verbundkapsel ist praktisch, aber jede einzelne Portion hinterlässt Abfall. Ohne einfache, funktionierende Rücknahme- und Recyclingpfade landet vieles im Restmüll. Das ist nicht nur eine Frage der Entsorgungskosten, sondern auch der Ressourcenschonung. Wer auf Großpackungen oder wiederbefüllbare Lösungen setzt, kann Abfall vermeiden – oft sogar günstiger.
Bei Energydrinks geht es um Gesundheit. Pulver mit hoher Koffeinkonzentration verlangt Präzision bei der Dosierung. Für Jugendliche ist das besonders heikel. Stimmungsschwankungen, Schlafprobleme oder Herzrasen sind mögliche Folgen übermäßiger Zufuhr. Verantwortungsvolle Vermarktung, klare Warnhinweise und eine Gestaltung, die Kinder nicht gezielt anspricht, sind daher essenziell. Im Zweifel gilt: Wasser und ungesüßte Tees sind die sicherere Alltagswahl.
Auch bei „High Protein“-Produkten hilft der Blick auf Fakten. Ein prägnanter Claim ersetzt keinen Nährwertvergleich. Wer Sport treibt, profitiert von ausreichend Eiweiß – doch die günstigste und sinnvollste Quelle muss nicht das prominent beworbene Produkt sein. Eigenmarken oder klassische Lebensmittel wie Topfen, Bohnen oder Eier sind häufig kosteneffiziente Alternativen. Es lohnt sich, den Preis pro Proteinmenge zu vergleichen.
Zahlen und Fakten: Was sich berechnen lässt
- Kapsel-Kakao: Laut Foodwatch kostet eine Tasse aus der Kapselvariante rund 50 Prozent mehr als klassisch zubereiteter Nesquik. Bei 0,40 Euro pro Tasse klassisch wären das 0,60 Euro pro Kapsel – die Differenz summiert sich spürbar über das Jahr. Dieser Vergleich illustriert den Effekt, ohne eine konkrete Handelsliste zu ersetzen.
- Verbundkapseln: Jede Tasse erzeugt eine einzelne, schwer recycelbare Kapsel. Hochgerechnet auf regelmäßigen Konsum entstehen erhebliche Abfallmengen. Entscheidend ist, ob es praktikable Rücknahmesysteme gibt – fehlt das, bleibt die ökologische Bilanz kritisch.
- Shrinkflation beim Keks: 250 Gramm auf 200 Gramm bei gleichem Regalpreis entspricht einer Preissteigerung von 25 Prozent pro Kilogramm. Beispielrechnung: 2,50 Euro pro 250 Gramm entsprechen 10 Euro/kg; 2,50 Euro pro 200 Gramm sind 12,50 Euro/kg.
- Sirup mit Immunversprechen: Laut Foodwatch besteht der Sirup zu zwei Dritteln aus Zucker. Trotz zugesetzter Mikronährstoffe gilt: Der Gesamteindruck darf nicht suggerieren, das Produkt sei per se gesundheitsfördernd. Der zulässige Satz „trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei“ ist kontextabhängig und muss korrekt platziert sein.
- High-Protein-Versprechen: Im Vergleich zu einigen fettreduzierten Eigenmarken, so Foodwatch, kann der Eiweißgehalt des beworbenen Cottage Cheese niedriger sein – bei höherem Preis. Hier hilft der Vergleich pro 100 Gramm und pro Euro.
Diese Punkte basieren auf der Foodwatch-Quelle. Konkrete Marktpreise variieren je nach Händler, Region und Zeitpunkt.
Rechtliche Einordnung in Österreich
In Österreich greifen mehrere Ebenen: EU-Recht für Health Claims, nationale Bestimmungen zur Kennzeichnung und das Lauterkeitsrecht gegen irreführende geschäftliche Handlungen. Maßstab ist oft der Gesamteindruck. Ein Produkt darf nicht so präsentiert werden, dass durchschnittliche Konsumentinnen und Konsumenten über wesentliche Merkmale – wie Menge, Zusammensetzung oder Wirkungen – getäuscht werden. Für Gesundheitsangaben gilt: Nur zulässige, wissenschaftlich abgesicherte Aussagen sind erlaubt und müssen so kommuniziert werden, dass sie nicht übertrieben wirken. Die Marktaufsicht kann Verstöße prüfen; zivilgesellschaftliche Kampagnen wie der „Werbeschmäh des Jahres“ erhöhen zusätzlich den öffentlichen Druck.
Expertenstimme aus der Quelle
Indra Kley-Schöneich, Leiterin von Foodwatch Österreich, wird in der OTS-Aussendung mit den Worten zitiert: „Wir zeigen, wo Konsumentinnen und Konsumenten in die Irre geführt werden – und fordern ein Ende der manipulativen Werbeversprechen.“ Diese Position fasst die Stoßrichtung der Kampagne zusammen: Transparenz statt Täuschung, klare Information statt überbordender Verpackungsinszenierung.
Zukunftsperspektive: Transparenz und digitale Tools
Wie geht es weiter? Drei Trends zeichnen sich ab. Erstens: Mehr digitale Informationen. QR-Codes können auf Produktseiten führen, die Nährwerte, Herkunft und Verarbeitungsdetails erklären. Das senkt Platzdruck auf der Verpackung und erlaubt differenzierte, ständig aktualisierte Hinweise. Zweitens: Stärkere Vergleichbarkeit. Verbraucherinnen und Verbraucher fordern verständliche, einheitliche Systeme – ob bei Nährwertkennzeichnungen oder Grundpreisen. Je klarer der Vergleich, desto geringer die Angriffsfläche für Täuschung. Drittens: Kreislaufwirtschaft. Verpackungen werden so gestaltet, dass sie sich leichter recyceln lassen. Monomaterialien, Pfadabhängigkeiten im Sammelsystem und Rücknahmeangebote rücken ins Zentrum.
Für Unternehmen bedeutet das: Wer langfristig Vertrauen will, setzt auf ehrliche Kommunikation. Ein „High Protein“-Claim ist dann stichhaltig, wenn er im direkten Vergleich überzeugt. Ein Immun-Hinweis bleibt glaubwürdig, wenn Zuckeranteile nicht dominieren und die zulässige Aussage kontextgerecht eingebettet ist. Für Konsumentinnen und Konsumenten wird der Alltag einfacher, wenn Fakten leichter auffindbar sind – auf dem Etikett, per QR-Klick oder in transparenten Online-Datenblättern.
So stimmen Sie ab und melden Aufreger
Die Wahl zum „Werbeschmäh des Jahres“ läuft bis 8. Dezember 2025 auf werbeschmaeh-des-jahres.at. Wer weitere Produkte melden möchte, kann das ganzjährig über das-regt-mich-auf.at tun. Beide Plattformen dienen als Sammelstellen für Fälle, die aus Sicht der Öffentlichkeit Diskussion verdienen. Für vertiefende Rechtsfragen empfehlen sich außerdem behördliche Informationsangebote sowie unabhängige Verbraucherportale.
Praktische Tipps für den Einkauf
- Grundpreise vergleichen: Euro pro Kilogramm oder Liter sagen mehr als der Regalpreis.
- Nährwerte lesen: Protein, Zucker, Salz und Fett pro 100 Gramm geben Orientierung.
- Claims einordnen: „Trägt zur normalen Funktion … bei“ ist kein Heilversprechen.
- Verpackungen prüfen: Große Dosen bedeuten nicht automatisch mehr Inhalt.
- Abfall bedenken: Kapsellösungen sind bequem, aber erzeugen zusätzlichen Müll.
Fazit und Ausblick
Der „Werbeschmäh des Jahres“ ist mehr als ein Negativpreis. Er ist ein Barometer für das Spannungsfeld zwischen Marketing, Erwartung und Wirklichkeit. Die diesjährigen Beispiele – von der Kakaokapsel über den Energydrink bis zum geschrumpften Keks – zeigen, wie relevant die Themen Preiswahrnehmung, Gesundheitsangaben und Verpackungsabfall sind. Österreich steht dabei nicht isoliert: Im EU-Kontext entwickeln sich Regeln weiter, während zivilgesellschaftliche Aktionen die Debatte lebendig halten.
Wie sehen Sie das? Teilen Sie Ihre Beobachtungen, stimmen Sie ab und achten Sie beim nächsten Einkauf auf Grundpreise und Nährwerte. Weiterführende Infos zur Wahl finden Sie bei Foodwatch, zur aktuellen Aussendung bei OTS. Mehr Hintergründe bieten unsere Dossiers zu Lebensmittelkennzeichnung, Shrinkflation und Health Claims.