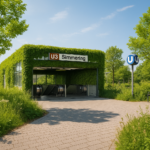Neue UFOP-Umfrage vom 03.11.2025: Viele unterschätzen Hülsenfrüchte – was das für Österreichs Ernährung, Klima und Landwirtschaft bedeutet. In Österreich wächst das Interesse an regionalen, nachhaltigen Lebensmitteln, doch ein nüchterner Blick auf aktuelle Daten aus Deutschland zeigt: Das Wissen über die Stärken von Hülsenfrüchten ist oft lückenhaft. Das ist bemerkenswert, weil Ackerbohnen, Erbsen, Linsen oder Sojabohnen sowohl auf dem Teller als auch am Feld gleich mehrere Vorteile verbinden. Die Erkenntnisse sind für Österreich relevant: Ernährungsgewohnheiten, Handelsstrukturen und Umweltziele in der DACH-Region sind eng verwoben. Wer hierzulande bewusst einkauft, kocht und Biodiversität fördern möchte, kommt an Hülsenfrüchten kaum vorbei – und doch bleiben Chancen ungenutzt. Dieser Artikel ordnet die Ergebnisse ein, erklärt zentrale Fachbegriffe verständlich, vergleicht Entwicklungen im deutschsprachigen Raum und zeigt, wie Bürgerinnen und Bürger, Kantinen und Landwirtschaft in Österreich von Hülsenfrüchten profitieren können.
Hülsenfrüchte im Faktencheck: Was die Umfrage zeigt
Der landwirtschaftliche Verband UFOP lässt den Status quo nüchtern messen: In einer von B2con durchgeführten Verbraucherumfrage mit 1.030 Personen in Deutschland zeigt sich, dass weniger als die Hälfte der Befragten weiß, dass keine andere pflanzliche Lebensmittelgruppe so viel Eiweiß liefert wie Hülsenfrüchte. 38 Prozent gaben an, diese Eigenschaft sei ihnen bisher nicht bekannt gewesen. Beim Klima- und Umweltprofil ist das Bild ähnlich: Rund 45 Prozent sehen Hülsenfrüchte als klimafreundlich, 52 Prozent als umweltfreundlich. Für Österreich ist diese Einsicht bedeutsam, denn die österreichische Küche integriert Erbsen, Bohnen und Linsen traditionell – vom Linseneintopf bis zum Fisolensalat –, doch das ernährungsbezogene Wissen über Protein, Ballaststoffe und Stickstoffbindung ist auch hier nicht selbstverständlich verbreitet.
UFOP-Geschäftsführer Stephan Arens bringt es auf den Punkt: »Hülsenfrüchte sind wertvoll für eine ausgewogene und nachhaltige Ernährung, ihr Potenzial wird aber noch nicht ausgeschöpft.« Er betont die ernährungsphysiologischen Vorteile und den Beitrag zum Klimaschutz durch die Fähigkeit, Stickstoff aus der Luft zu binden – ein natürlicher Prozess, der den Bedarf an mineralischem Dünger reduzieren kann. Für die österreichische Debatte um nachhaltige Beschaffung in Schulen, Spitälern und Betriebsküchen liefert das einen praktischen Ansatz: Mehr Hülsenfrüchte auf den Speiseplan, mehr regionale Wertschöpfung, weniger ökologische Belastung.
Fachbegriff erklärt: Hülsenfrüchte und Körnerleguminosen
Hülsenfrüchte sind Samen von Pflanzen aus der Familie der Leguminosen, die in Hülsen wachsen. Typische Beispiele sind Erbsen, Bohnen, Linsen, Lupinen und Sojabohnen. Als »Körnerleguminosen« bezeichnet man Arten, die primär wegen ihrer Samen genutzt werden, nicht wegen Schoten als Gemüse. Sie zeichnen sich durch einen hohen Gehalt an pflanzlichem Protein und Ballaststoffen aus. Für Laien wichtig: Hülsenfrüchte sind trockene, lange lagerfähige Lebensmittel. Sie lassen sich kostenschonend einkaufen, flexibel verarbeiten (Eintopf, Salat, Aufstrich) und tragen, richtig zubereitet, zu einer ausgewogenen Ernährung bei. Gleichzeitig liefern sie sekundäre Pflanzenstoffe und Mineralstoffe wie Eisen, Magnesium und Zink, die in der Alltagsernährung oft zu kurz kommen.
Fachbegriff erklärt: Pflanzliches Protein
Pflanzliches Protein ist Eiweiß, das aus Pflanzen stammt – im Gegensatz zu tierischem Eiweiß aus Fleisch, Fisch, Eiern oder Milch. Proteine sind essenziell für Muskeln, Enzyme, Hormone und das Immunsystem. Hülsenfrüchte gehören zu den proteinreichsten pflanzlichen Lebensmitteln. Für Laien wichtig: Die biologische Wertigkeit – also wie gut der Körper das Protein verwerten kann – steigt, wenn man verschiedene pflanzliche Quellen kombiniert (zum Beispiel Getreide mit Hülsenfrüchten). So ergänzen sich Aminosäurenprofile. In der Praxis heißt das: Ein Linseneintopf mit Vollkornbrot oder ein Bohneneintopf mit Reis ist nicht nur sättigend, sondern versorgt den Körper mit ausgewogenem Protein, ganz ohne tierische Zutaten.
Fachbegriff erklärt: Stickstoffbindung
Die Stickstoffbindung bezeichnet die Fähigkeit von Leguminosen, in Symbiose mit speziellen Bodenbakterien (Rhizobien) Stickstoff aus der Luft in eine pflanzenverfügbare Form zu überführen. Für Nicht-Expertinnen und Nicht-Experten: Luft besteht zu rund 78 Prozent aus Stickstoff, doch Pflanzen können den gasförmigen Stickstoff nicht direkt nutzen. Über Knöllchenbakterien an den Wurzeln entsteht ein natürlicher Dünger. Das spart mineralischen Stickstoffdünger, verringert Emissionen, verbessert die Bodenfruchtbarkeit und unterstützt vielfältige Fruchtfolgen. In Österreichs Ackerbau kann diese Eigenschaft helfen, Betriebsmittel zu sparen und die Bodengesundheit zu fördern – ein zentrales Ziel nachhaltiger Landwirtschaft.
Fachbegriff erklärt: Mineralischer Dünger
Mineralischer Dünger ist industriell hergestellter Dünger, der Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor und Kalium in konzentrierter Form enthält. Er wirkt schnell, ist aber energieintensiv in der Herstellung. Insbesondere die Produktion von Stickstoffdünger benötigt viel Energie. Für Laien: Dünger ist nicht per se »schlecht«, er hilft Pflanzen beim Wachsen. Aber wenn Leguminosen einen Teil des Stickstoffbedarfs über Symbiosen decken, verringert sich der Bedarf an zugekauften Düngern. Das kann Kosten reduzieren, die Umwelt entlasten und die Unabhängigkeit landwirtschaftlicher Betriebe stärken. Hülsenfrüchte leisten hier einen praktischen Beitrag, ohne dass Erträge in anderen Kulturen zwangsläufig leiden müssen.
Fachbegriff erklärt: Ballaststoffe
Ballaststoffe sind unverdauliche Bestandteile pflanzlicher Lebensmittel, die im Darm quellen, sättigen und eine gesunde Verdauung fördern. Sie sind wichtig für ein stabiles Mikrobiom, tragen zu einem ausgeglichenen Blutzuckerspiegel bei und können das Sättigungsgefühl verlängern. Hülsenfrüchte liefern besonders viele lösliche und unlösliche Ballaststoffe. Für den Alltag bedeutet das: Gerichte mit Linsen, Kichererbsen oder Bohnen sind oft länger sättigend als solche aus reinem Weißmehl. Wer neu einsteigt, sollte die Mengen schrittweise erhöhen und ausreichend Wasser trinken. So gewöhnt sich die Verdauung an die höhere Ballaststoffzufuhr.
Fachbegriff erklärt: Ernährungsfachgesellschaften
Ernährungsfachgesellschaften sind wissenschaftlich orientierte Organisationen, die Empfehlungen für eine gesundheitlich ausgewogene Ernährung erarbeiten. Für den DACH-Raum sind die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), die Österreichische Gesellschaft für Ernährung (ÖGE) und die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE) zentrale Ansprechpartnerinnen. Sie beobachten Studienlagen, aktualisieren Leitlinien und geben alltagsnahe Empfehlungen. Sowohl die DGE als auch die ÖGE empfehlen, Hülsenfrüchte regelmäßig in den Speiseplan zu integrieren. Das ist keine Mode, sondern fachlich begründet: Hülsenfrüchte vereinen Nährstoffqualität mit Nachhaltigkeitsvorteilen.
Fachbegriff erklärt: Lebenszyklus-Analyse (LCA)
Eine Lebenszyklus-Analyse (Life Cycle Assessment, LCA) bewertet Umweltauswirkungen eines Produkts von der Produktion bis zur Entsorgung. Bei Lebensmitteln umfasst das Anbau, Verarbeitung, Transport, Lagerung, Zubereitung und Abfall. Für Laien: LCAs zeigen, wo die größten Emissionen entstehen und welche Stellschrauben wirksam sind. Hülsenfrüchte schneiden in vielen LCA-Betrachtungen im Vergleich zu verschiedenen tierischen Proteinen vorteilhaft ab, weil ihr Anbau in der Regel weniger Treibhausgasemissionen verursacht. Entscheidend ist dennoch der Kontext: Regionale Herkunft, Transportwege, Anbausysteme und Verarbeitung beeinflussen die Bilanz. Wer in Österreich zu regionalen Hülsenfrüchten greift, kann Transportemissionen begrenzen.
Historischer Kontext: Hülsenfrüchte in Österreich und Europa
Hülsenfrüchte begleiten die europäische Ernährung seit Jahrhunderten. Lange bevor Kartoffeln verbreitet waren, galten Erbsen und Bohnen als wichtigste Eiweißquellen der einfachen Küche. In ländlichen Regionen Österreichs wurden Linsen, Bohnen und Fisolen als lagerfähige Sattmacher geschätzt. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg, steigenden Einkommen und wachsender Verfügbarkeit tierischer Produkte verloren Hülsenfrüchte an Sichtbarkeit. Gleichzeitig führte die Intensivierung der Landwirtschaft zu Fruchtfolgen mit einem stärkeren Fokus auf Getreide und Mais, während Körnerleguminosen zurücktraten.
Spätestens mit dem wachsenden Bewusstsein für Klima, Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit rücken Hülsenfrüchte wieder in den Blick. Politisch unterstützt wurde diese Entwicklung durch EU-Programme, die Diversifizierung und Fruchtfolge fördern. Die Erklärung des Jahres 2016 zum International Year of Pulses durch die Vereinten Nationen brachte Hülsenfrüchte zudem in die öffentliche Debatte. In Österreich erlebten regionale Initiativen, Direktvermarktung und Kooperationsprojekte zwischen Landwirtschaft und Gastronomie einen Schub. Wiederentdeckte Sorten, handwerklich produzierte Aufstriche oder Teigwaren aus Linsenmehl sind Beispiele einer Renaissance, die nicht nur auf Nischenmärkte beschränkt bleibt.
Heute verbinden Hülsenfrüchte historische Tradition mit zeitgemäßer Ernährungskompetenz. Während der Alltag vieler Haushalte von schnellen Gerichten geprägt ist, ermöglichen vorgegarte Produkte und Tiefkühlware einen unkomplizierten Einstieg. Für Schulen, Kantinen und Betriebsküchen eröffnet das ein Spielfeld für abwechslungsreiche, preisbewusste Speisepläne, die ernährungsphysiologisch überzeugen und ökologische Ziele unterstützen. Die öffentliche Beschaffung in Österreich diskutiert seit Jahren Kriterien für Gesundheit und Nachhaltigkeit – Hülsenfrüchte sind ein Baustein, der historische Erfahrungen und moderne Anforderungen zusammenführt.
Vergleich: Österreich, Deutschland, Schweiz
Die DACH-Länder teilen kulturelle und wirtschaftliche Verflechtungen – das gilt auch für Ernährung. Deutschland hat mit der UFOP-Umfrage einen aktuellen Datenpunkt, der Wissenslücken sichtbar macht. Österreich steht vor ähnlichen Herausforderungen: Obwohl ÖGE-Empfehlungen klar sind und die Vielfalt am Markt wächst, bleibt die Alltagskompetenz, Hülsenfrüchte regelmäßig und schmackhaft zu integrieren, ausbaufähig. Die Schweiz setzt in der öffentlichen Diskussion stark auf regionale Wertschöpfung und Qualität. In allen drei Ländern empfehlen die jeweiligen Fachgesellschaften, Hülsenfrüchte regelmäßig in den Speiseplan einzubauen. Unterschiede liegen eher in Marktstrukturen und kulinarischen Routinen: In Österreich sind Fisolen und Linsen in traditionellen Gerichten vertraut; in Deutschland hat die vegane und vegetarische Szene Hülsenfrüchte stark modern interpretiert; in der Schweiz findet man hochwertige Convenience-Produkte, die die Zubereitungszeit verkürzen.
Für die Landwirtschaft ergeben sich in der DACH-Region ähnliche Vorteile: Leguminosen stärken Fruchtfolgen, unterstützen Bodenleben und können externe Düngerkosten reduzieren. Unterschiede betreffen regionale Klima- und Bodenverhältnisse sowie Vermarktungswege. Österreich profitiert von kurzer Distanz zwischen Anbau, Verarbeitung und Konsum – ein Hebel, der die Umweltbilanz zusätzlich verbessern kann, wenn Hülsenfrüchte gezielt in regionale Wertschöpfungsketten integriert werden.
Konkreter Nutzen für Bürgerinnen und Bürger in Österreich
Was bedeutet das für den Alltag? Erstens: Eine bewusste Integration von Hülsenfrüchten hilft, die Proteinversorgung abwechslungsreich zu gestalten. Beispiele: Linsensalat mit Kürbiskernöl als schnelles Abendessen; Eintopf mit Bohnen, Wurzelgemüse und österreichischen Kräutern; Fisolen in der Pfanne mit Zwiebeln und Knoblauch als Beilage zu Erdäpfeln. Zweitens: Wer sein Haushaltsbudget im Blick hat, profitiert von der Lagerfähigkeit und dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis getrockneter Ware. Drittens: Für Menschen, die weniger tierische Produkte essen möchten, bieten Hülsenfrüchte eine vielseitige Basis, ohne auf Nährstoffqualität zu verzichten.
Für Bildungseinrichtungen und Großküchen bieten Hülsenfrüchte Planbarkeit: Sie sind standardisierbar, gut lagerbar und in großen Mengen verfügbar. Für Gemeinden, die nachhaltige Beschaffungskriterien berücksichtigen, ist das ein Pluspunkt. Kantinen können abwechselnd Linsenbolognese, Erbsencurry, Bohneneintopf oder Linsenlaibchen anbieten – Gerichte, die bei geschickter Würzung breite Akzeptanz finden. Ein weiterer Aspekt: Wer langsam steigert und auf Einweich- sowie Kochzeiten achtet (oder vorgegarte Produkte nutzt), verbessert Verträglichkeit und Küchenablauf.
In der Landwirtschaft ergeben sich konkrete Spielräume: Hülsenfrüchte können Fruchtfolgen auflockern und den Zukauf von Stickstoffdünger reduzieren. Das mindert Risiken bei Preisvolatilität von Betriebsmitteln und stärkt die Resilienz. Regionale Kooperationen mit Verarbeitern – etwa Mühlen, die Linsen- oder Bohnenmehle herstellen – schaffen zusätzliche Absatzwege. Für Direktvermarktung bieten Hülsenfrüchte ein stimmiges Narrativ: regional, nahrhaft, klimabewusst.
Zahlen und Fakten aus der UFOP-Umfrage: Einordnung und Bedeutung
Die Umfrage umfasst 1.030 Befragte in Deutschland. Das ist für Verbraucherbefragungen eine solide Größe, die erlaubt, Tendenzen sichtbar zu machen. Kernbefunde: Weniger als die Hälfte kennt den außergewöhnlich hohen Proteingehalt von Hülsenfrüchten; 38 Prozent kannten diese Eigenschaft bis dato nicht. Lediglich etwa 45 Prozent stufen Hülsenfrüchte als klimafreundlich ein, während 52 Prozent sie als umweltfreundlich wahrnehmen. Diese Differenz verdeutlicht, dass Klimaschutz- und Umweltaspekte im Alltagsverständnis nicht deckungsgleich sind: Klimafreundlichkeit wird oft unmittelbar mit Treibhausgasen verbunden, Umweltfreundlichkeit hingegen breiter – inklusive Boden, Wasser, Biodiversität.
Was folgt daraus für Österreich? Erstens: Informationsarbeit wirkt. Wenn Menschen die ernährungsphysiologischen und ökologischen Vorzüge kennen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie häufiger zu Hülsenfrüchten greifen – das bestätigt die Praxis vieler Ernährungsprojekte. Zweitens: Der Klimabeitrag durch Stickstoffbindung ist erklärungsbedürftig. Je greifbarer Kommunen, Schulen und Betriebe die Vorteile kommunizieren, desto eher gelingt die Umstellung. Drittens: Die Verfügbarkeit alltagstauglicher Produkte – von regionalen Linsen über Bohnenkonserven bis zu TK-Erbsen – erleichtert den Schritt von der Empfehlung zur Gewohnheit.
Expertenstimme aus der Quelle
UFOP-Geschäftsführer Stephan Arens sagt: »Hülsenfrüchte sind wertvoll für eine ausgewogene und nachhaltige Ernährung, ihr Potenzial wird aber noch nicht ausgeschöpft.« Weiter betont er: »Neben ernährungsphysiologischen Vorteilen leisten Hülsenfrüchte auch einen Beitrag zum Klimaschutz. Sie binden Stickstoff aus der Luft und reduzieren dadurch den Bedarf an mineralischem Dünger.« Diese Einordnung deckt sich mit den Empfehlungen der Fachgesellschaften und liefert Anknüpfungspunkte für die Ernährungspolitik in Österreich, etwa bei Leitlinien für Gemeinschaftsverpflegung.
Praxis: Einkauf, Lagerung und Zubereitung
Wer Hülsenfrüchte in den Alltag integrieren will, kann pragmatisch starten: Trockenware ist günstig und lange haltbar; Konserven und Gläser sind sofort einsatzbereit; Tiefkühl-Erbsen sind ideal für schnelle Küche. Geschmack und Verträglichkeit profitieren vom Einweichen (bei Bohnen und Kichererbsen) und genügend Kochzeit. Gewürze wie Lorbeer, Kreuzkümmel, Majoran, Paprika oder Bohnenkraut passen hervorragend. Österreichische Klassiker lassen sich modern interpretieren: Linsen mit Erdäpfeln und Kernöl, pikante Bohnensuppe mit Räucheraroma aus Paprika und Rauchsalz, Fisolen als lauwarmer Salat mit Zwiebeln und Apfelessig. Für schnelle Gerichte eignen sich Linsenbolognese, Erbsen-Minze-Pesto oder Bohnenaufstriche auf Vollkornbrot.
Checkliste für den Start
- Mit bekannten Sorten beginnen: rote Linsen, Tellerlinsen, weiße Bohnen, Erbsen.
- Vorgegarte Produkte nutzen, um Kochzeiten zu sparen.
- Gerichte planen, die sich gut aufwärmen lassen (Eintopf, Curry, Sauce).
- Mit Kräutern und Gewürzen Geschmackstiefe schaffen.
- Langsam steigern und ausreichend trinken – Ballaststoffe wirken.
Politik und Programme: Kampagnen im Überblick
Die Kampagne »DIE VIER VON HIER! Körnerleguminosen aus Europa für eine nachhaltige Ernährung« wird von der Europäischen Union finanziert und von der UFOP in Deutschland und Österreich zwischen Februar 2024 und Januar 2027 durchgeführt. Ziel ist, Wissen zu vermitteln, das Image zu verbessern und Konsumgewohnheiten in Richtung ausgewogener, nachhaltiger Ernährung zu verändern. Wichtig ist der Hinweis: Die geäußerten Ansichten und Meinungen in den Materialien repräsentieren die Autorinnen und Autoren und nicht zwingend die Position der EU oder ihrer Exekutivagentur. Für Österreich sind solche Kampagnen ein Baustein neben nationalen Leitlinien und regionalen Initiativen, die öffentliche Beschaffung, Gastronomie und Konsumentinnen und Konsumenten adressieren.
Zukunftsperspektive: Wie sich Markt und Alltag entwickeln könnten
Die nächsten Jahre versprechen Dynamik. Erstens ist zu erwarten, dass Ernährungsbildung in Schulen, Gesundheitseinrichtungen und Medien Hülsenfrüchte stärker in den Fokus rückt. Je mehr praktikable Rezepte, alltagstaugliche Produkte und regionale Geschichten verfügbar sind, desto schneller wird aus einer Empfehlung gelebte Gewohnheit. Zweitens spricht vieles dafür, dass Landwirtinnen und Landwirte Hülsenfrüchte gezielt in Fruchtfolgen integrieren, um Bodenfruchtbarkeit zu stärken und Betriebsmittelkosten zu stabilisieren. Drittens dürften Verarbeiter und Handel das Sortiment ausbauen – von heimischen Linsen über Bohnenteigwaren bis zu hochwertigen Convenience-Produkten für die Gemeinschaftsverpflegung.
Für Österreichs Klimaziele ist der Beitrag nicht allein eine Frage der Emissionen. Hülsenfrüchte fördern die Resilienz landwirtschaftlicher Systeme, indem sie Vielfalt erhöhen und Abhängigkeiten reduzieren. In der öffentlichen Beschaffung können verbindliche Qualitätskriterien – saisonal, regional, ausgewogen – Hülsenfrüchte selbstverständlich machen. Wenn Konsumentinnen und Konsumenten, Küchen und Landwirtschaft an einem Strang ziehen, entsteht ein selbstverstärkender Kreislauf: mehr Nachfrage, stabilere Produktion, bessere Verfügbarkeit und sinkende Hürden in der Alltagsküche.
Weiterführende Informationen und interne Links
Quellen und Lesetipps:
- Presseaussendung der Quelle »Die Vier von hier«: ots.at
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Ernährungskreis): dge.de
- Österreichische Gesellschaft für Ernährung (10 Ernährungsregeln): oege.at
Interne Verlinkungen für vertiefende Inhalte:
- Schwerpunkt Ernährung
- Ratgeber: Rezepte mit Hülsenfrüchten
- Wissen: Klimaschutz in der Landwirtschaft
Schluss: Wissen teilen, Vielfalt genießen
Die UFOP-Umfrage vom 03.11.2025 macht deutlich: Viele unterschätzen Hülsenfrüchte – ihre Nährstoffdichte, ihren Beitrag zum Klimaschutz und ihre Rolle in einer regionalen, resilienten Landwirtschaft. Für Österreich ist das eine Chance. Wer Linsen, Bohnen, Erbsen und Lupinen häufiger einplant, profitiert im Alltag und stärkt zugleich ökologische Ziele. Ernährungsfachgesellschaften wie die ÖGE und DGE empfehlen den regelmäßigen Verzehr nicht ohne Grund: Er ist praktisch, vielfältig und wissenschaftlich gut begründet.
Was können Sie heute tun? Probieren Sie ein neues Rezept, fragen Sie in der Kantine nach einer Linsen- oder Bohnenoption, und achten Sie beim Einkauf auf regionale Herkunft. Kleine Schritte genügen, um Hülsenfrüchte zur Gewohnheit zu machen. Weitere Informationen finden Sie in den verlinkten Leitfäden und bei vertrauenswürdigen Institutionen. Und eine offene Frage zum Weiterdenken: Wenn Hülsenfrüchte so viele Vorteile bündeln – welche Hürde hält uns noch davon ab, sie in Österreich zur ersten Wahl auf dem Speiseplan zu machen?