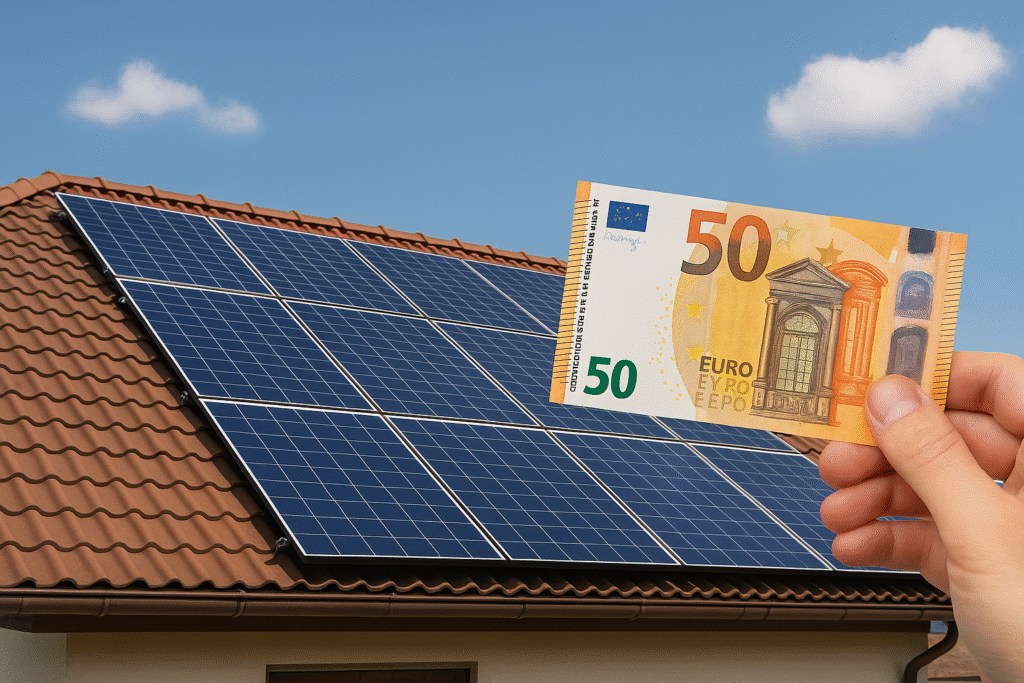Neues Stromgesetz vom 18.11.2025: kleine PV-Anlagen ohne Einspeisegebühr und stärkere Speicher. Auswirkungen auf Stromkosten und Netze in Österreich. Wer in Österreich auf Photovoltaik setzt, soll künftig spürbar entlastet werden – das ist die Kernbotschaft eines heute im Ministerrat beschlossenen Gesetzesentwurfs. Besonders für Niederösterreich, wo viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer bereits auf das Dachkraftwerk setzen, könnte das zu schnelleren Amortisationszeiten und mehr Planungssicherheit führen. Der Entwurf verspricht auch eine gezieltere Einbindung von Speichern als Netz-Stoßdämpfer. Was das konkret bedeutet, wie sich die angekündigte Ausnahme für kleine private Anlagen von der Einspeisegebühr auswirkt und welche nächsten Schritte politisch folgen, ordnen wir ein – mit Blick auf die Praxis, den österreichischen Rechtsrahmen und den Vergleich zu Deutschland und der Schweiz.
Neues Stromgesetz entlastet kleine PV-Anlagen: Was beschlossen wurde
Laut der Aussendung des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung wurde am 18.11.2025 im Ministerrat ein Gesetzesentwurf beschlossen, der mehrere Maßnahmen für stabile Stromkosten, sichere Versorgung und eine Entlastung der Netze vorsieht. Zentral: Kleine private Photovoltaik-Anlagen sollen künftig keine Einspeisegebühr zahlen müssen. Größere private Anlagen wären weiterhin betroffen. Gleichzeitig setzt das Paket auf eine stärkere Einbindung von Speichertechnologien, die als „Stoßdämpfer“ im Stromnetz wirken und damit langfristig Kosten senken können.
Aus Niederösterreich kommt politischer Rückenwind: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner spricht von einem „ersten wichtigen Schritt“, um die Energiekosten in Österreich zu dämpfen. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf betont die Notwendigkeit, auch größere private Anlagen von der Gebühr auszunehmen, damit engagierte Energiepionierinnen und -pioniere nicht benachteiligt werden. Zugleich wird ein rascher Beschluss im Parlament eingefordert, damit die Verbesserungen tatsächlich bei den Menschen ankommen. Die öffentliche Quelle mit den Originalzitaten findet sich hier: OTS-Meldung des Amtes der NÖ Landesregierung.
Fachbegriffe verständlich erklärt
Einspeisegebühr
Die Einspeisegebühr ist eine Abgabe beziehungsweise ein Entgelt, das beim Einspeisen von selbst erzeugtem Strom aus einer Photovoltaik-Anlage in das öffentliche Netz anfallen kann. In der Praxis decken solche Gebühren administrative Prozesse, Messung, Abrechnung und Netznutzung ab. Für Haushalte mit PV-Anlage bedeutet eine Einspeisegebühr, dass ein Teil des wirtschaftlichen Vorteils aus dem Verkauf überschüssigen Solarstroms geschmälert wird. Wird diese Gebühr für kleine private Anlagen gestrichen, verbessert das die Wirtschaftlichkeit: Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer können rascher die Investitionskosten amortisieren. Wichtig: Die genaue Ausgestaltung und Definition, wann und in welcher Form die Gebühr anfällt, wird im Gesetz geregelt, das nach dem Ministerrat noch vom Parlament beschlossen werden muss.
Speichertechnologien
Unter Speichertechnologien versteht man technische Lösungen, die Energie zwischenlagern, um sie zeitversetzt zu nutzen. Im Wohnbereich sind das vor allem Batteriespeicher, die tagsüber aus der PV-Anlage geladen werden und den gespeicherten Strom abends oder nachts zur Verfügung stellen. Für das Stromsystem wirken Speicher wie ein Puffer: Wenn viel Solarstrom vorhanden ist, nehmen sie Energie auf; wenn wenig erneuerbare Erzeugung verfügbar ist, geben sie Energie wieder ab. Diese Pufferwirkung stabilisiert das Netz, kann Lastspitzen abfedern und reduziert damit kostenintensive Eingriffe in den Netzbetrieb. Für Haushalte senken Speicher den Zukauf von teurem Netzstrom zu Spitzenzeiten und erhöhen den Eigenverbrauchsanteil des selbst erzeugten Solarstroms.
Netzentlastung
Netzentlastung beschreibt Maßnahmen, die die Auslastung der Stromleitungen und -infrastruktur reduzieren oder gleichmäßiger verteilen. Bei hoher Einspeisung aus dezentralen Erneuerbaren können lokal Engpässe entstehen. Speicher, intelligente Steuerung (Lastmanagement) und flexible Tarife helfen, Erzeugung und Verbrauch zeitlich besser aufeinander abzustimmen. Je weniger Spitzen gleichzeitig auftreten, desto weniger muss das Netz ausgebaut oder in der Spitze vorgehalten werden. Das senkt langfristig die Netzkosten und damit den Druck auf die Strompreise. Entlastung bedeutet also nicht nur kurzfristige Stabilität, sondern auch geringere Investitionen in Zusatzkapazitäten, die sonst über die Entgelte finanziert würden.
Ministerrat
Der Ministerrat ist die regelmäßige Sitzung der österreichischen Bundesregierung, in der Regierungsmitglieder politische Vorhaben beraten und Beschlüsse fassen. Ein im Ministerrat beschlossener Gesetzesentwurf ist ein wichtiger Zwischenschritt im Gesetzgebungsprozess. Danach wird der Entwurf dem Parlament zugeleitet. Erst Nationalrat und Bundesrat beschließen Gesetze verbindlich. Für Bürgerinnen und Bürger bedeutet ein Ministerratsbeschluss, dass die politische Einigung innerhalb der Regierung steht, aber die endgültige Rechtsverbindlichkeit erst nach dem parlamentarischen Verfahren eintritt. Bis dahin können sich Details noch ändern, etwa durch Abänderungsanträge im Ausschuss oder im Plenum.
Prosumer
Der Begriff Prosumer setzt sich aus Producer (Produzent) und Consumer (Verbraucher) zusammen und bezeichnet Personen oder Haushalte, die Strom nicht nur konsumieren, sondern auch selbst erzeugen und teilweise ins Netz einspeisen. Prosumerinnen und Prosumer sind im österreichischen Energiesystem eine wichtige Säule der Energiewende, weil sie erneuerbare Erzeugung dezentral bereitstellen. Mit Photovoltaik und Speicher erhöhen sie die Eigenversorgung, senken Lastspitzen im Netz und können – je nach Marktsituation – überschüssigen Strom regional nutzbar machen. Regulatorische Fragen wie Einspeisegebühren, Messkosten und Tarife bestimmen dabei maßgeblich die Wirtschaftlichkeit und die Akzeptanz.
Netzkosten
Netzkosten sind jene Ausgaben, die für Bau, Betrieb, Instandhaltung und Modernisierung der Stromnetze entstehen. Sie werden über Netzentgelte auf die Nutzerinnen und Nutzer umgelegt und sind ein wesentlicher Bestandteil der Stromrechnung. Wachsen Einspeisung und Verbrauch stark, kann das Netzausbau und technische Aufrüstung nötig machen. Umgekehrt können Flexibilitätsinstrumente wie Speicher, steuerbare Verbraucher (etwa Wärmepumpen) und Lastmanagement die Kostenentwicklung dämpfen, weil sie die Spitzenlast reduzieren. Politische Maßnahmen, die Netzkosten senken, schaffen Spielraum für niedrigere Strompreise und unterstützen die Wettbewerbsfähigkeit von Haushalten und Betrieben.
Historische Entwicklung: Wie wir hierher kamen
Österreich hat in den vergangenen Jahren einen deutlichen Ausbau der Photovoltaik erlebt. Treiber waren sinkende Modulpreise, Förderprogramme von Bund und Ländern sowie ein wachsendes Bewusstsein für Versorgungssicherheit und Klimaschutz. Mit der zunehmenden Zahl an privaten Anlagen stiegen aber auch die Anforderungen an das Verteilnetz: An sonnigen Tagen speisen viele Dächer gleichzeitig Strom ein, während der Verbrauch im Tagesverlauf schwankt. Netzbetreiberinnen und Netzbetreiber müssen darauf reagieren, um Spannung und Frequenz stabil zu halten.
Regulatorisch wurden wiederholt Instrumente diskutiert, die Einspeisung steuern, Netze ertüchtigen und Kosten fair verteilen. Die Debatten drehten sich um Messkonzepte, Abrechnung, Einspeiseentgelte und technische Standards. Parallel wuchs die Rolle des Speichers: Anfangs als teure Nischenlösung belächelt, etablieren sich Batteriesysteme zunehmend als Bestandteil des Haushalts-Energiemanagements. Sie glätten Erzeugung und Verbrauch, erhöhen den Eigenverbrauchsanteil und entlasten das Netz.
Der nun vorliegende Gesetzesentwurf reiht sich in diese Entwicklung ein. Er reagiert auf die Sorge, dass kleine private PV-Anlagen durch Gebühren demotiviert würden, obwohl sie politisch gewollt sind. Eine Ausnahmeregelung für kleine Anlagen signalisiert: Die Energiewende im Kleinen soll nicht bestraft werden. Zugleich zeigt die stärkere Einbindung von Speichertechnologien, dass der Gesetzgeber Flexibilität als Schlüssel begreift. Das Ziel ist ein System, in dem dezentrale Erzeugung wirtschaftlich bleibt, ohne das Netz zu überfordern. Der heutige Beschluss im Ministerrat öffnet das Tor zum parlamentarischen Feinschliff, in dem Begriffe wie „klein“ konkretisiert und Übergangsfristen festgezurrt werden.
Vergleich: Bundesländer, Deutschland und Schweiz
Innerhalb Österreichs unterscheiden sich die Rahmenbedingungen für Photovoltaik vor allem bei Förderakzenten und Verwaltungsprozessen. Niederösterreich hat in den vergangenen Jahren stark auf den Ausbau privater PV-Anlagen gesetzt und Bewusstseinsarbeit geleistet. Eine explizite Ausnahme kleiner Anlagen von einer Einspeisegebühr auf Bundesebene würde den in Niederösterreich eingeschlagenen Weg stützen: mehr Eigenstrom, weniger Hürden. Andere Bundesländer profitieren gleichermaßen, etwa in ländlichen Regionen mit hohem Dachflächenpotenzial. Wo Netze bereits angespannt sind, könnte die gesetzliche Betonung von Speichern den Druck reduzieren.
Deutschland hat seit 2022 die frühere EEG-Umlage abgeschafft. Für kleine PV-Anlagen gibt es Vereinfachungen, etwa steuerlich und bei der Abnahme überschüssigen Stroms. Netzentgelte und Messentgelte bestehen jedoch fort, und die Integration vieler dezentraler Erzeuger bleibt eine Aufgabe. Der österreichische Ansatz, kleine Anlagen von einer Einspeisegebühr auszunehmen und Speicher stärker einzubinden, folgt der Logik, Kleinerzeugung zu fördern und zugleich Flexibilität zu erhöhen. Er ist mit deutschen Entwicklungen kompatibel, setzt aber eigene Schwerpunkte beim Netzpuffer über Speicher.
In der Schweiz werden Rückspeisetarife von lokalen Energieversorgern festgelegt, und es gibt je nach Netzgebiet unterschiedliche Regelungen und Messkosten. Die frühere nationale Einspeisevergütung wurde durch andere Fördermechanismen abgelöst, während Eigenverbrauchsmodelle wichtiger wurden. Österreichs Fokus auf die Netzentlastung durch Speicher ähnelt der schweizerischen Tendenz, Flexibilität zu honorieren. Zugleich zeigt der Ländervergleich, dass einfache, klare Regeln für kleine Anlagen die Akzeptanz stark erhöhen. Die Detailausführung – etwa Definitionen, Meldevorgänge und Abrechnungslogik – entscheidet darüber, ob Entlastungen in der Praxis reibungslos ankommen.
Konkrete Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger
Was bedeutet die geplante Ausnahme von der Einspeisegebühr für kleine PV-Anlagen im Alltag? Zunächst verbessert sich die Wirtschaftlichkeit: Wer eine typische Dachanlage auf dem Einfamilienhaus betreibt, profitiert davon, dass beim Verkauf überschüssigen Stroms keine zusätzliche Gebühr anfällt. Das erhöht die Erlöse aus der Einspeisung und verkürzt, abhängig von Investitionskosten und Ertrag, die Amortisationszeit. In Kombination mit einem Speicher steigt der Eigenverbrauchsanteil, und teurer Strombezug am Abend sinkt. Damit werden Stromkosten planbarer.
Ein Beispiel: Eine Familie in St. Pölten betreibt eine typische Anlage im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Kilowattpeak-Bereich und ergänzt diese mit einem Heimspeicher mittlerer Kapazität. Tagsüber laden die Module den Speicher, abends versorgt er das Haus. Überschüsse gehen ins Netz. Fällt für diese kleine private Anlage keine Einspeisegebühr an, bleibt mehr vom Einspeiseertrag. Das ist keine Garantie für Gewinne, aber es stabilisiert die Kalkulation. Wichtig ist, dass die exakten Schwellenwerte und Bedingungen – was gilt als klein, wie wird gemessen, welche Übergangsregeln gibt es – gesetzlich klar definiert werden. Erst dann wissen Betreiberinnen und Betreiber, ob ihre Anlage erfasst ist.
Auch Mieterinnen und Mieter können profitieren, wenn das Regelwerk Mieterstrom- oder Gemeinschaftsmodelle indirekt erleichtert. Zwar zielt die nun angekündigte Entlastung vorrangig auf kleine private Anlagen, aber die Fokussierung auf Speichertechnologien kann auch Mehrparteienhäusern helfen: Wenn Strom in der Liegenschaft besser verteilt und vorrangig selbst genutzt wird, sinkt die Netzbelastung im Quartier. Das kann langfristig Netzkosten dämpfen und so über die allgemeinen Entgelte alle versorgten Haushalte erreichen.
Zahlen und Fakten: Was jetzt feststeht – und was noch offen ist
Fest steht laut Quelle: Kleine private Photovoltaik-Anlagen sollen keine Einspeisegebühr zahlen müssen; größere private Anlagen bleiben betroffen. Zudem wird die stärkere Einbindung von Speichertechnologien als Mittel zur Netzstabilisierung und Kostendämpfung hervorgehoben. Nicht fest steht nach derzeitigem Informationsstand aus der Presseaussendung: die konkrete Definition der Größe, etwa in Kilowattpeak, Schwellenwerte für die Befreiung, etwaige Deckelungen, Übergangsfristen oder Details zur Abrechnung. Diese Punkte werden im parlamentarischen Verfahren präzisiert.
Zur Einordnung typischer Größenordnungen in der Praxis: Viele Einfamilienhaus-Anlagen liegen häufig im Bereich von mehreren Kilowattpeak, je nach Dachfläche, Ausrichtung und Budget. Heimspeicher im privaten Bereich bewegen sich nicht selten in Kapazitäten, die den Abend- und Nachtverbrauch abdecken können. Solche Orientierungen dienen der Praxis, ersetzen aber nicht die rechtliche Definition von „klein“, die das Gesetz liefern muss. Sobald der Gesetzestext veröffentlicht wird, ist mit detaillierten FAQ der Behörden und Netzbetreiber zu rechnen, die Messkonzepte, Meldewege und Abrechnung erklären.
Ökonomisch ist die Logik klar: Jede entfallende Gebühr auf kleine Einspeisemengen verbessert den Deckungsbeitrag einer Anlage. Parallel kann die systemweite Einbindung von Speichern teure Netzspitzen glätten. Gelingt beides, resultiert daraus mittelfristig ein doppelter Effekt auf Stromkosten: direkt bei Prosumerinnen und Prosumern und indirekt über die Netzentgelte. Wie stark der Effekt ausfällt, hängt jedoch von Marktentwicklungen (Anlagenpreise, Stromgroßhandel), technischen Standards und der konkreten Tarifgestaltung ab.
Stimmen aus Niederösterreich
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wird in der Quelle mit der Einschätzung zitiert, man habe von Beginn an „klar gesagt: Es darf zu keiner Bestrafung jener Menschen kommen, die mit einer privaten Photovoltaikanlage ihren Beitrag zur Energiewende leisten“. Das Gesetzespaket berücksichtige das, ein wichtiger Schritt sei gesetzt, die Arbeit an weiteren Entlastungen – insbesondere bei den Netzkosten – müsse aber weitergehen. Sie stellt die Relevanz für Österreichs Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand in den kommenden Monaten und Jahren heraus.
LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf nennt das Paket „einen ersten notwendigen Schritt“, um Stromkosten zu senken und die Versorgung zu stabilisieren. Er begrüßt die Ausnahme kleiner privater PV-Anlagen und die bessere Einbindung von Speicherlösungen, mahnt aber an, auch größere private Anlagen auszunehmen, damit engagierte Energiepionierinnen und -pioniere nicht bestraft werden. Zentral ist für ihn ein rascher Beschluss im Parlament, damit die Verbesserungen bei den Menschen ankommen.
Zukunftsperspektive: Was kommt als Nächstes?
Mit dem Ministerratsbeschluss startet die parlamentarische Phase. In den kommenden Wochen ist zu erwarten, dass der Entwurf in den zuständigen Ausschuss geht, wo Expertinnen und Experten gehört und Detailfragen geschärft werden. Dabei stehen mehrere Punkte im Fokus: Definition der „kleinen privaten PV-Anlage“, Mess- und Abrechnungslogik, Übergangsregelungen für bestehende Anlagen sowie mögliche Anreize für Speicher, ohne den Wettbewerb zu verzerren. Je klarer und einfacher die Regeln, desto schneller können Installationsbetriebe, Netzbetreiberinnen und Förderstellen Prozesse anpassen.
Für Haushalte und Gewerbe zeichnet sich eine Perspektive ab, in der Photovoltaik mit Speicher zur neuen Normalität wird. Digitale Zähler, variable Tarife und smarte Steuerung könnten die Wirkung des Gesetzes verstärken: Wer Lasten verschiebt, Eigenverbrauch optimiert und das Netz schont, profitiert doppelt – durch geringere Stromkosten und eine systemische Entlastung. Für das Energiesystem gilt: Mehr Flexibilität bedeutet weniger kostspielige Spitzen. Gelingt die Umsetzung, kann Österreich seine Klimaziele mit höherer Akzeptanz verfolgen, ohne die Netzstabilität zu gefährden.
Praxiswissen und weitere Informationen
Wer jetzt plant oder bereits eine Anlage betreibt, sollte die Veröffentlichung des Gesetzestextes und allfällige Verordnungen im Auge behalten. Bis zur Beschlussfassung im Parlament und dem Inkrafttreten können sich Details ändern. Unsere vertiefenden Ratgeber unterstützen bei der Orientierung:
- Photovoltaik-Förderungen 2025: Überblick für Österreich
- Stromkosten im Haushalt senken: 25 Praxistipps
- Heimspeicher im Vergleich: Technologien, Größen, Preise
- Energiegesetz-Novellen: Was Haushalte wissen müssen
Zusätzliche Einordnung und Rechtssicherheit
Bitte beachten: Die hier wiedergegebenen Inhalte basieren auf der öffentlichen Presseaussendung des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung vom 18.11.2025. Konkrete Rechtsfolgen ergeben sich erst aus dem beschlossenen Gesetzestext und gegebenenfalls aus ergänzenden Verordnungen. Für individuelle Investitionsentscheidungen sollten Betreiberinnen und Betreiber Beratung durch Fachbetriebe oder Energieberaterinnen und -berater einholen und die offiziellen Informationen der Behörden und Netzbetreiber prüfen.
Häufige Fragen aus der Praxis
- Gilt meine Anlage als klein? – Das wird der Gesetzestext definieren. Bis dahin empfiehlt sich Zurückhaltung bei endgültigen Kalkulationen.
- Was bringt ein Speicher zusätzlich? – Höherer Eigenverbrauch, geringerer Zukauf in teuren Stunden, Pufferwirkung fürs Netz.
- Wie schnell wirkt die Entlastung? – Nach Beschluss im Parlament und Inkrafttreten. Übergangsregeln sind abzuwarten.
Quellenhinweis
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung: Presseaussendung vom 18.11.2025 „Stromkosten: Neuer Gesetzesentwurf bringt Entlastung für kleine PV-Anlagen“. Online abrufbar unter: OTS.
Schluss: Was jetzt zählt
Der Ministerrat hat am 18.11.2025 die Weichen für eine Entlastung kleiner privater PV-Anlagen gestellt und Speicher als Systempuffer aufgewertet. Für Österreichs Haushalte bedeutet das Aussicht auf planbarere Stromkosten, für das Netz mehr Flexibilität. Entscheidend wird, wie das Parlament die Details festlegt: klare Definitionen, einfache Prozesse, faire Übergänge. Unser Fazit: Wer eine PV-Anlage plant oder betreibt, sollte die Gesetzgebung eng verfolgen und parallel die eigene Anlagenauslegung prüfen – inklusive Speicheroption.
Bleiben Sie informiert, teilen Sie diesen Beitrag mit Bekannten, die eine Photovoltaik-Anlage erwägen, und nutzen Sie unsere Ratgeber für die nächsten Schritte. Weiterführende Informationen und Updates zum Gesetz finden Sie laufend auf 123haus.at in den verlinkten Dossiers.