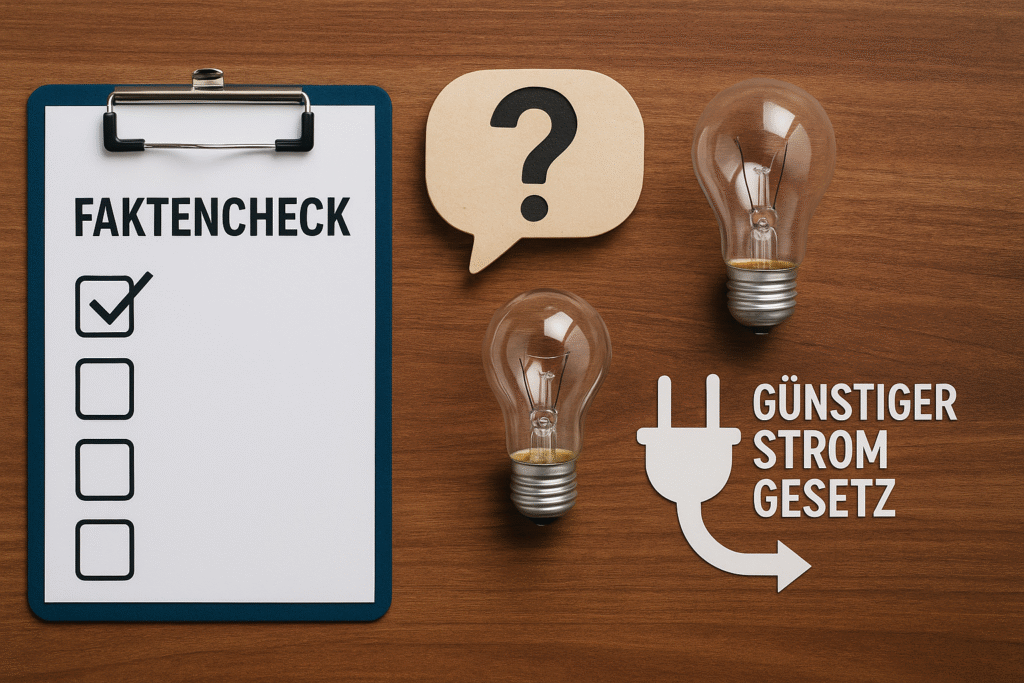Österreich diskutiert am 21. November 2025 erneut leidenschaftlich über Strompreise, Netzkosten und die richtige Energiepolitik. Der Auslöser: Aussagen der Staatssekretärin Michaela Schmidt in einem TV-Interview und eine unmittelbare Replik der Erneuerbaren-Branche. Was steckt dahinter, was bedeutet der Österreich-Aufschlag, und wie wirkt das Günstiger-Strom-Gesetz für Haushalte und Betriebe? Dieser Faktencheck ordnet ein, erklärt Fachbegriffe und zeigt, welche Hebel Strom in Österreich tatsächlich günstiger machen könnten. Grundlage sind öffentlich zugängliche Informationen und die aktuelle Stellungnahme der Erneuerbaren-Branche, die ihren Faktencheck transparent verlinkt hat. Für Bürgerinnen und Bürger zählt am Ende die Rechnung: Wie kommen seriöse, faire Preise zustande – und welche Rolle spielen Abgaben, Netze und heimische Erzeugung?
Faktencheck zum Günstiger-Strom-Gesetz und Österreich-Aufschlag
Die Branchenvertretung der erneuerbaren Energieerzeugerinnen und -erzeuger in Österreich hat nach dem TV-Interview wesentliche Punkte klargestellt. Den vollständigen Faktencheck finden Leserinnen und Leser unter dem Link der Originalquelle: Erneuerbare Energie Österreich – Faktencheck. Diese Stellungnahme kritisiert insbesondere drei verbreitete Missverständnisse: erstens die Zuschreibung der Inflation an Energieversorgerinnen und Energieversorger, zweitens die Behauptung, Erzeuger würden keine Netzkosten bezahlen, und drittens vereinfachte Preisvergleiche auf Basis einzelner Cent-Beträge. Außerdem wird vor den Folgen eines Österreich-Aufschlags im Rahmen des Günstiger-Strom-Gesetzes gewarnt.
Weil Energiepolitik tief in Alltagskosten, Investitionsentscheidungen und die Wettbewerbsfähigkeit greift, lohnt der Blick auf Begriffe, Mechanismen und historische Entwicklungen. Nur so lässt sich beurteilen, wie plausibel die Argumente sind – und welche Maßnahmen tatsächlich geeignet sind, Strompreise nachhaltig zu stabilisieren und zugleich den Ausbau erneuerbarer Energie zu sichern.
Begriff erklärt: Strompreisbremse
Die Strompreisbremse war eine zeitlich befristete staatliche Entlastungsmaßnahme, die aus öffentlichen Mitteln einen Teil der Stromkosten für Haushalte abfederte. Sie setzte an der Endkundenrechnung an und reduzierte den Preis bis zu einem definierten Grundverbrauch. Für Laien wichtig: Sie ändert nicht die eigentlichen Erzeugungskosten oder Netztarife, sondern wirkt wie ein Zuschuss auf der Rechnung. Läuft eine solche Bremse aus, steigt die ausgewiesene Rechnung automatisch an – selbst wenn die Großhandelspreise oder Netzentgelte gleich bleiben. Dieser rein rechnerische Sondereffekt kann die Inflation kurzfristig nach oben treiben, weil Strom ein Teil des Warenkorbs ist, nach dem die Teuerungsrate gemessen wird. Fällt der Sondereffekt zu einem späteren Zeitpunkt weg, sinkt die gemessene Inflation entsprechend wieder, ohne dass einzelne Unternehmen ihren Preis verändert haben müssen.
Begriff erklärt: Netzkosten
Netzkosten sind jene Entgelte, die für den Betrieb, die Instandhaltung und den Ausbau der Stromnetze anfallen. Sie setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, etwa Netzanschlussentgelten, Netznutzungsentgelten, Netzverlustentgelten, Messentgelten, Bereitstellungsentgelten und Entgelten für Systemdienstleistungen. Diese Gebühren sind notwendig, damit Strom zuverlässig von der Erzeugung zum Verbrauch transportiert werden kann. Nach Darstellung der Erneuerbaren-Branche leisten auch Betreiberinnen und Betreiber von Wind- und Photovoltaikanlagen heute bereits substanzielle Beiträge zu diesen Kosten. Der Anteil der Netzkosten an den Gesamtausgaben eines Windparks wird mit rund 5 bis 10 Prozent angegeben. Zusätzlich ist zu beachten: Wenn Strom aus dem Ausland importiert wird, fallen innerhalb Österreichs für diesen Strom keine inländischen Netzkosten auf Ebene der Erzeugung an. Das kann bei gleichen Großhandelspreisen einen Wettbewerbsunterschied erzeugen und heimischen Strom relativ verteuern.
Begriff erklärt: Merit-Order
Die Merit-Order ist ein marktliches Reihungssystem, nach dem Kraftwerke in der Strombörse eingesetzt werden. Zuerst kommen die Anlagen mit den niedrigsten Grenzkosten zum Zug, zuletzt die teuersten. Der Preis am Großhandelsmarkt wird durch das letzte, noch benötigte Kraftwerk – das Grenzkraftwerk – bestimmt. Viele österreichische Wasserkraft-, Wind- und PV-Anlagen haben sehr niedrige Grenzkosten, aber in Zeiten geringer Verfügbarkeit, vor allem im Winter, können teurere Kraftwerke mit fossilen Brennstoffen preisbestimmend sein. Die Branchenstellungnahme weist darauf hin, dass die gemeinsame Merit-Order im Winter zu einem erheblichen Teil der Zeit nicht greift oder verfälscht ist, etwa durch regionale Engpässe oder eingeschränkte Kopplungen, was die Wirkung nationaler Auf- oder Abschläge auf Endkundenrechnungen beeinflusst. Für Konsumentinnen und Konsumenten heißt das: Nicht jeder politische Eingriff wirkt in allen Stunden gleich – saisonale und netztechnische Faktoren sind entscheidend.
Begriff erklärt: Stromgestehungskosten
Stromgestehungskosten – international oft als LCOE (Levelized Cost of Electricity) bezeichnet – beschreiben die durchschnittlichen Kosten pro erzeugter Kilowattstunde über die gesamte Lebensdauer einer Anlage. Sie umfassen Investitionskosten, Betrieb und Wartung, Kapitalkosten sowie gegebenenfalls Brennstoffe. Für Wind- und PV-Anlagen bestehen die Kosten überwiegend aus Investition und Finanzierung, weil Sonne und Wind keine Brennstoffkosten verursachen. Die Erneuerbaren-Branche nennt für Österreich einen Durchschnittswert von knapp 9 Cent pro Kilowattstunde. Wichtig: Dieser Wert ist ein Mittel. Einzelne Anlagen sind teurer oder günstiger, je nach Standort, Technologie, Zinsen und Netzanbindung. Pauschale Vergleiche wie 3 Cent versus 15 Cent blenden diese Vielfalt aus und taugen nicht als Grundlage für politische Pauschalurteile.
Begriff erklärt: Energiegemeinschaften
Energiegemeinschaften sind rechtliche Zusammenschlüsse von Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinden, Vereinen und Unternehmen, die lokal erzeugten Strom gemeinsam nutzen oder teilen. Ziel ist, regionalen Strom effizient vor Ort zu verwerten, Netzbelastungen zu reduzieren und Teilhabe am Wandel zu ermöglichen. Laut Branchenangabe gibt es in Österreich bereits über 3.800 solcher Gemeinschaften. Praktisch bedeutet das: Ein Wohnhaus mit PV-Anlage kann Strom mit dem Nachbarhaus teilen, ein Verein kann seine Mitglieder versorgen, oder mehrere Betriebe können gemeinsam in eine Windkraftanlage investieren. Rechtlich ist dafür ein Rahmen geschaffen worden, der Abrechnung, Messung und Netzfragen regelt. Eingriffe in die Preisbildung, die Direktbelieferungen oder regionale Modelle verteuern, treffen diese Gruppen unmittelbar und können den Ausbau ausbremsen.
Begriff erklärt: Österreich-Aufschlag
Als Österreich-Aufschlag wird ein geplanter preislicher Zuschlag auf Strom innerhalb Österreichs bezeichnet, der im Zuge des Günstiger-Strom-Gesetzes in die Diskussion gelangt ist. Die Erneuerbaren-Branche argumentiert, dass ein solcher Aufschlag die heimische Erzeugung verteuert – zunächst direkt durch den Zuschlag, noch stärker aber indirekt durch höhere Finanzierungskosten, wenn Investitionen riskanter erscheinen. Das kann dazu führen, dass neue Wind- und PV-Projekte verschoben oder kleiner geplant werden. Bleibt der Ausbau zurück, steigt die Abhängigkeit von Importen, was die Preisschwankungen erhöhen kann. Aus Perspektive der Stromkundinnen und Stromkunden bedeutet ein Aufschlag: kurzfristig höhere Preise, langfristig ein schwächerer Ausbau, der die Chance auf dauerhaft günstigeren Strom schmälert.
Historische Einordnung: Von der Liberalisierung zur Krisenpolitik
Die österreichische Stromwirtschaft ist seit der Marktliberalisierung schrittweise von einem monopolähnlichen System in einen regulierten Wettbewerb übergegangen. Mit dem Ökostromgesetz und späteren Novellen wurden Einspeisetarife, Förderregime und Ausbaupfade festgelegt, um Wasser-, Wind- und Sonnenkraft voranzubringen. Ein Meilenstein war das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), das die Ziele für 100 Prozent erneuerbaren Strom bilanziell bis zum Ende des Jahrzehnts präzisierte und neue Förderinstrumente etablierte. Parallel wurde in den Netzausbau investiert, weil mehr dezentrale Einspeiserinnen und Einspeiser höhere Anforderungen an Lastfluss, Messung und Systemdienstleistungen stellen.
Die Energiekrise ab 2021/2022 mit stark schwankenden Großhandelspreisen hat zu Sonderschutzmaßnahmen geführt, darunter die Strompreisbremse. Sie wirkte wie ein temporäres Preisschild auf der Rechnung der Haushalte und entlastete damit spürbar. Mit dem Auslaufen solcher Maßnahmen kommt es – unabhängig vom Verhalten einzelner Unternehmen – rechnerisch zu einem sprunghaften Anstieg der gemessenen Preise, der in der Inflationsstatistik sichtbar wird. Genau darauf weist die Erneuerbaren-Branche hin: Der größte Effekt auf die Inflation sei durch das automatische Ende der Bremse entstanden; dieser Sondereffekt ende Anfang 2026, wodurch die Inflationsrate rein rechnerisch sinke. Dieses Argument ist aus methodischer Sicht plausibel: Indexkorrekturen verzerren temporär die Teuerungsrate, ohne die realen Kostenstrukturen der Erzeugung fundamental zu verändern.
Gleichzeitig rückte die Frage in den Vordergrund, wie Binnenmarktregeln, Grenzkuppelungen und nationale Aufschläge zusammenwirken. Österreich ist mit seinen Nachbarländern eng vernetzt. Das Stromsystem lebt vom Austausch – etwa wenn im Winter weniger PV-Strom verfügbar ist oder die Flussführung der Wasserkraft eingeschränkt wird. In solchen Phasen entscheidet sich, ob nationale Zuschläge die Endpreise erhöhen, ohne die gewünschte Lenkungswirkung zu erzielen. Die Branchenanalyse warnt folglich vor einem Österreich-Aufschlag: Er sei nicht nur wirkungsschwach in kritischen Stunden, sondern auch kontraproduktiv für Investitionen.
Vergleich: Bundesländer, Deutschland und die Schweiz
Innerhalb Österreichs zeigen sich Unterschiede vor allem beim Ausbaupfad der Erzeugung und bei regionalen Netzgegebenheiten. Bundesländer mit starkem Windpotenzial – etwa das Burgenland und Teile Niederösterreichs – tragen wesentlich zum Wachstum der Windkraft bei. Regionen mit hoher Alpenwasserkraft – wie Tirol, Salzburg oder Vorarlberg – sichern flexible Leistung für Spitzenzeiten. In urbanen Räumen wie Wien oder Graz spielt Photovoltaik auf Dächern eine zunehmend wichtige Rolle, während ländliche Regionen neben PV auch Freiflächenprojekte vorantreiben. Diese Vielfalt bedeutet, dass Netzkosten, Anschlusszeiten und die Integration neuer Anlagen je nach Bundesland unterschiedlich herausfordernd sind. Ein bundesweiter Aufschlag trifft damit sehr heterogene Situationen und kann in manchen Regionen den Ausbau stärker dämpfen als in anderen.
Deutschland hat in der Krise mit Preisbremsen und gezielten Entlastungen reagiert und setzt weiterhin stark auf Netzausbau, um Windstrom aus dem Norden in die Verbrauchszentren zu transportieren. Gleichzeitig wurden dort Vergütungsmechanismen für Erneuerbare angepasst, um trotz Zinserhöhungen Investitionssicherheit zu geben. Die Erfahrung zeigt: Wenn die Finanzierungskosten steigen, müssen Ausschreibungsdesign und Risikoallokation sensibel justiert werden – sonst bleiben Auktionen unterzeichnet, und Kapazitäten fehlen. Das ist für Österreich unmittelbar relevant, weil auch hier Projektfinanzierungen auf stabile Rahmenbedingungen angewiesen sind.
Die Schweiz ist traditionell durch Wasserkraft geprägt und hat stark auf Versorgungssicherheit durch Speicherseen gesetzt. In den vergangenen Jahren kommt PV hinzu, vor allem auf Dächern. Netzseitig verfolgt die Schweiz wie Österreich das Prinzip kostendeckender Entgelte, die allerdings nach Topografie, Dichte und Ausbaupfad variieren. Ein nationaler Zuschlag, der die heimische Erzeugung verteuert, würde in einem vernetzten europäischen Markt tendenziell zu mehr Importen motivieren – was bei Engpässen oder hohen Nachbarpreisen die Preissensitivität erhöht. Der Vergleich verdeutlicht: Investitionsfreundliche Rahmenbedingungen und zielgenaue Entlastungen wirken robuster als generische Aufschläge, die die Binnenproduktion schwächen.
Was bedeutet das für Bürgerinnen, Bürger und Betriebe?
Für Haushalte entscheidet am Ende die Stromrechnung. Diese setzt sich aus Energiepreis, Netzentgelten sowie Steuern und Abgaben zusammen. Laut Stellungnahme der Erneuerbaren-Branche machen Steuern und Abgaben rund ein Drittel der Rechnung aus. Eine unmittelbare Entlastung entstünde daher am schnellsten durch die Reduktion dieser Abgaben, nicht durch neue Zuschläge. Beispiel: Eine vierköpfige Familie in einer Mietwohnung mit durchschnittlichem Verbrauch profitiert kurzfristig stärker von einer Abgabensenkung als von strukturellen Preisaufschlägen, die zudem über die Finanzierungskosten künftiger Projekte auf die Rechnung zurückwirken.
Für kleine und mittlere Unternehmen – etwa Bäckereien, Tischlereien oder Metallbetriebe – zählt neben dem Preis die Planbarkeit. Wenn Finanzierungskosten für Eigenstromprojekte steigen, weil der Markt unsicher wird, verschiebt sich die Kalkulation: Ein PV-Dach rechnet sich später, eine Beteiligung an einer Energiegemeinschaft wird zurückgestellt. Das schwächt langfristig die Resilienz gegenüber Preisschocks. Für Energiegemeinschaften selbst – die Branche spricht von über 3.800 in Österreich – bedeutet jeder Aufschlag oder jedes regulatorische Hemmnis ein Investitionsrisiko. Wer heute einen Speicher plant, kalkuliert mit Laufzeiten von zehn bis fünfzehn Jahren. Schon kleine Zins- oder Preisveränderungen machen Projekte fragil.
Im ländlichen Raum kommt ein weiterer Aspekt dazu: Der Netzausbau. Wenn Einspeisepunkte fehlen oder Netzkosten einen hohen Anteil an Projektkosten ausmachen, verlängern sich Genehmigungs- und Realisierungszeiten. Die Erneuerbaren-Branche beziffert die Netzkosten bei Windparks mit 5 bis 10 Prozent der Gesamtausgaben und verweist darauf, dass in den letzten 15 Jahren knapp eine Milliarde Euro aus PV- und Windkraft in den Netzausbau geflossen sind. Für Bürgerinnen und Bürger heißt das: Investitionen in Netze sind keine abstrakte Größe, sondern Voraussetzung, damit regionale Projekte ans Netz gehen und lokal erzeugter Strom überhaupt genutzt werden kann. Der Nutzen zeigt sich später in stabileren Preisen und regionaler Wertschöpfung.
Zahlen, Fakten und ihre Einordnung
Die Branchenstellungnahme führt mehrere Eckwerte an, die wir hier ordnen:
- Wind- und PV-Kraftwerke liefern rund 20 Prozent des Stroms in Österreich. Ein beachtlicher Beitrag, der neben der dominanten Wasserkraft die Diversifizierung stärkt. Je mehr wetterunabhängige und wetterabhängige Erzeugung kombiniert wird, desto stabiler wird das Gesamtsystem.
- Erneuerbare Energien weisen durchschnittliche Erzeugungskosten von knapp 9 Cent pro kWh auf. Das ist ein Mittelwert: Einzelanlagen können darüber oder darunter liegen. Entscheidend sind Zinsen, Standortqualität und Netzanbindung.
- Netzgebühren machen bei Windparks etwa 5 bis 10 Prozent der Gesamtkosten aus. Diese Spanne erklärt, warum pauschale Aussagen über Kostenstrukturen kaum zielführend sind – denn Projekte unterscheiden sich stark.
- In den letzten 15 Jahren sind knapp eine Milliarde Euro aus PV- und Windkraft in den Netzausbau geflossen. Diese Zahl zeigt: Erzeugerinnen und Erzeuger tragen bereits messbar zu Netzkosten bei.
- Für Stromimporte fallen in Österreich keine entsprechenden Netzkosten auf Erzeugerseite an. Das schafft einen Wettbewerbsunterschied zulasten heimischer Produktion.
- Über 3.800 Energiegemeinschaften bestehen bereits. Sie sind Drehscheiben für bürgernahe Energiewende und reagieren sensibel auf regulatorische Preisimpulse.
Zusammen betrachtet ergibt sich ein Bild: Österreich hat ein starkes Erzeugungsfundament, doch Finanzierungskosten und Netzkapazitäten sind die Nadelöhre. Ein zusätzlicher Österreich-Aufschlag wirkt wie ein Keil in die Kalkulationen neuer Projekte und kann eine Kettenreaktion auslösen: teurere Finanzierung, weniger Gebote in Ausschreibungen, geringerer Zubau – und auf Sicht höhere Endkundenpreise, wenn Importe einspringen müssen.
Warum einfache Cent-Vergleiche in die Irre führen
Wird mit 3 Cent gegen 15 Cent argumentiert, werden Äpfel mit Birnen verglichen. Erzeugungskosten einzelner, möglicherweise abgeschriebener Altanlagen sind nicht mit Vollkosten neuer Projekte gleichzusetzen. Viele österreichische Wind- und PV-Anlagen gehören Privatpersonen, Landwirtinnen und Landwirten sowie kleinen und mittleren Unternehmen, nicht Großkonzernen. Diese Vielfalt ist politisch gewollt und stärkt die Teilhabe, führt aber auch dazu, dass es keine Einheitskosten gibt. Seriöse Analysen arbeiten mit Spannbreiten und Szenarien statt mit zugespitzten Fixwerten. Für die Stromrechnung zählt am Ende die Summe aus Energiepreis, Netz, Steuern und Abgaben – nicht eine einzige Zahl aus einem Interview.
Rechtliche und regulatorische Perspektive
Strompreise entstehen in einem rechtlichen Rahmen aus EU-Vorgaben, nationalen Gesetzen und Verordnungen. Das Günstiger-Strom-Gesetz ist politisch umstritten, weil Befürworterinnen und Befürworter schnelle Entlastung erwarten, Kritikerinnen und Kritiker hingegen negative Wirkungen auf Investitionen fürchten. Die Branchenstellungnahme weist klar darauf hin, dass das Gesetz selbst keine unmittelbare Senkung bewirkt, sondern über Aufschläge sogar verteuern könne. Rechtssicher ist: Änderungen an Abgaben wirken unmittelbar auf die Endrechnung, strukturpolitische Maßnahmen wie Netzausbau und Genehmigungsbeschleunigung wirken mittel- bis langfristig über mehr Angebot und geringere Systemkosten. Wer kurzfristig entlasten will, senkt Abgaben; wer langfristig günstigen Strom will, stärkt Ausbau und Netze. Beides schließt einander nicht aus, muss aber sinnvoll aufeinander abgestimmt werden.
Zukunftsperspektive: Was jetzt zu tun ist
Für die kommenden Jahre ist entscheidend, Investitionssicherheit herzustellen. Zinsen bleiben womöglich höher als im vergangenen Jahrzehnt. Das erhöht die Kapitalkosten von Projekten. Ein regulatorischer Aufschlag auf den heimischen Markt verschärft dieses Problem. Stattdessen braucht es Planungsklarheit: stabile Ausschreibungsbedingungen, verlässliche Netzanschlussprozesse, ausreichende Mittel für Systemdienstleistungen und eine klare Perspektive für Energiegemeinschaften. So werden Banken bereit, Projekte zu finanzieren – und Bürgerinnen und Bürger, Gemeinden und Betriebe investieren.
Parallel sollten gezielte Entlastungen dort ansetzen, wo sie maximale Wirkung haben: bei Abgaben, die rund ein Drittel der Stromrechnung ausmachen. Eine temporäre, sozial treffsichere Reduktion kann schwierige Monate überbrücken, während Beschleunigungsmaßnahmen im Netzausbau und in Genehmigungen den strukturellen Engpass entschärfen. Wenn die Strompreisbremse als Sondereffekt ausläuft und die Inflation rechnerisch zurückgeht, entsteht politischer Spielraum für Strukturreformen ohne Inflationsdruck. Das Zielbild bleibt: mehr heimische erneuerbare Energie, robuste Netze, transparente Preisbestandteile – und ein Marktdesign, das die europäische Integration nutzt, ohne die heimische Erzeugung zu benachteiligen.
Praktische Tipps für Konsumentinnen und Konsumenten
- Tarif prüfen: Laufzeit, Preisgleitklauseln und Grundgebühren vergleichen. Wechsel kann Kosten senken.
- Verbrauch steuern: Lastspitzen vermeiden, Geräte bündeln, smarte Timer nutzen – besonders im Winterhalbjahr.
- Energiegemeinschaft erwägen: In Gemeinde oder Hausgemeinschaft nach Möglichkeiten fragen.
- Förderungen checken: Aktuelle Unterstützungen für PV, Speicher oder Effizienzmaßnahmen recherchieren.
Transparenz und Quellenlage
Die hier dargestellten Kernaussagen zu Inflationseffekt, Netzkostenanteilen, Investitionsbeiträgen in Netze, Erzeugungskosten, Energiegemeinschaften und der Wirkung eines Österreich-Aufschlags stammen aus der Stellungnahme der Erneuerbaren-Branche. Sie sind als Position der Branche zu verstehen. Unabhängige, laufend aktualisierte Marktdaten veröffentlichen österreichische Institutionen wie E-Control und Statistik Austria. Für den vollständigen Wortlaut und die Detail-Argumentation verweisen wir auf die Originalquelle.
- Quelle: Erneuerbare Energie Österreich – Faktencheck (Abruf 21.11.2025)
- E-Control: Markt- und Regulierungsinformationen
- Statistik Austria: Energie und Preise
Fazit und Ausblick
Österreich steht vor einer pragmatischen Wahl: kurzfristig entlasten, ohne langfristig zu belasten. Der Faktencheck der Erneuerbaren-Branche liefert dafür wichtige Anhaltspunkte. Er betont, dass die jüngste Inflationsspitze maßgeblich ein rechnerischer Effekt des Auslaufens der Strompreisbremse war, nicht das Ergebnis individueller Preissetzung. Er zeigt, dass Erzeugerinnen und Erzeuger Netzkosten tragen und in den Netzausbau investiert haben. Er warnt, dass ein Österreich-Aufschlag die heimische Erzeugung verteuern und Investitionen bremsen könnte – mit spürbaren Folgen für Haushalte, Betriebe und Energiegemeinschaften. Günstiger Strom entsteht demnach durch die Entlastung bei Abgaben und durch konsequenten Ausbau, nicht durch Zusatzlasten.
Für Leserinnen und Leser, die tiefer einsteigen wollen: Prüfen Sie den verlinkten Faktencheck der Branche, verfolgen Sie die laufenden Daten von E-Control und Statistik Austria und beobachten Sie die rechtliche Ausgestaltung des Günstiger-Strom-Gesetzes im parlamentarischen Prozess. Welche Maßnahmen halten Sie für wirkungsvoll, damit Strom in Österreich planbar und leistbar bleibt? Teilen Sie Ihre Erfahrungen aus Haushalt, Betrieb oder Energiegemeinschaft – die Debatte profitiert von konkreten Praxisberichten.