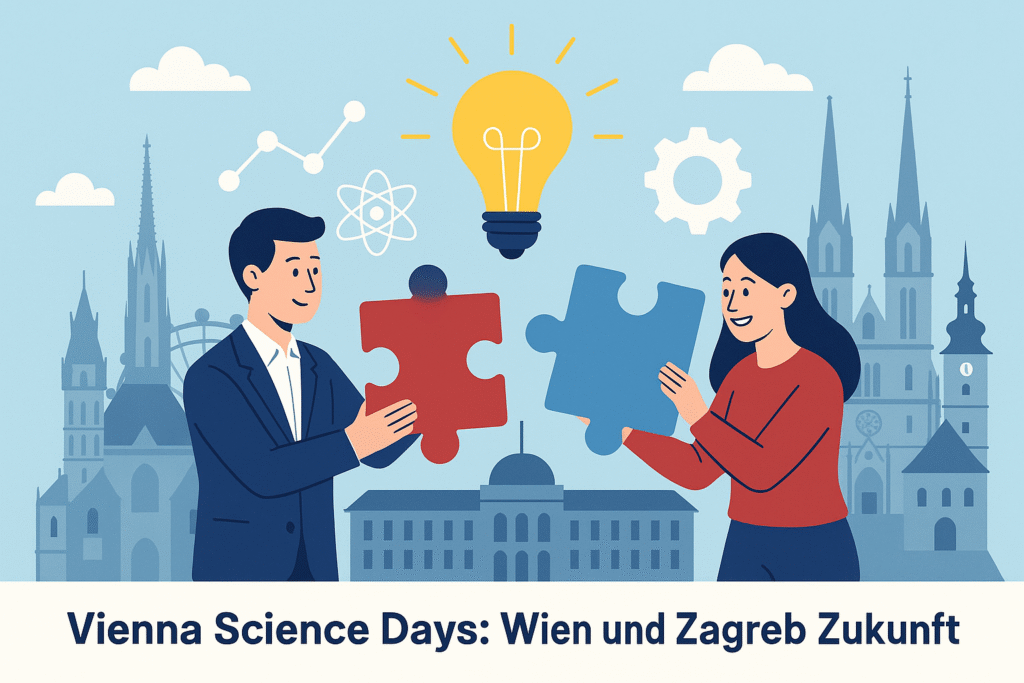Am 11. November 2025 rückt eine Kooperation in den Fokus, die für Österreichs Städte konkrete Antworten auf große Fragen verspricht. Wien und Zagreb vernetzten Forschung und Stadtverwaltung bei den Vienna Science Days in Zagreb, um gemeinsame Lösungen für Klimawandel, Digitalisierung und leistbares Wohnen vorzubereiten. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Nach Jahren beschleunigter technischer Entwicklung und spürbarer Klimafolgen steigen die Erwartungen an die öffentliche Hand. Die Konferenz, organisiert von den Internationalen Büros der Stadt Wien, bringt Verwaltung, Universitäten und Praxis zusammen – mit dem Ziel, aus Wissen umsetzbare Maßnahmen zu formen. Österreich profitiert unmittelbar: Erfahrungen aus Wien, ein Vorreiter beim geförderten Wohnbau, treffen auf Zagrebs Wiederaufbaukompetenz nach den Erdbeben von 2020 und auf europäische Best Practices in Robotik und Künstlicher Intelligenz. Was dabei herauskommt, ist mehr als ein Austausch – es ist ein Werkzeugkasten für urbane Resilienz, der auch in Wien, Graz, Linz und Salzburg Wirkung entfalten kann.
Vienna Science Days und urbane Stadtentwicklung: Kooperation als Schlüssel
Die Vienna Science Days in Zagreb fanden am 4. und 5. November 2025 statt. Ausgerichtet von den Internationalen Büros der Stadt Wien, einem Unternehmen der Wien Holding, bot die Konferenz eine Bühne für konkrete Fragen: Wie verändert der Klimawandel die Stadtplanung? Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz in der Verwaltung? Wie gelingt der Technologietransfer aus der Forschung in die Praxis? Und wie bleibt Wohnen leistbar? Quelle und vollständige Informationen: Stadt Wien – Kommunikation und Medien (KOM), OTS.
Denis Šakić, Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat, brachte den Grundgedanken auf den Punkt: „Angesichts der globalen Herausforderungen, wie leistbares Wohnen, Klimawandel und Digitalisierung, hat es keinen Sinn, dass jeder einzeln an der Zukunft arbeitet. Es geht nichts über ein Miteinander.“ In Zagreb zeigte sich, wie diese Haltung praktisch wird: Universitäten und Stadtverwaltungen analysieren gemeinsam Katastrophenrisiken, erproben KI-Anwendungen etwa bei Brückeninspektionen oder Bürgerinnen-Services und diskutieren klare Standards für klimafitte öffentliche Räume, von Baumpflanzungen bis zu Beschattungsmaßnahmen.
Die Universität Zagreb spielt seit den Erdbeben 2020 eine zentrale Rolle beim Wiederaufbau: Sie erstellt Schadensanalysen, Sanierungspläne, informiert die Öffentlichkeit über Risiken und wendet moderne Methoden des Erdbebenschutzes an. Gleichzeitig treibt das Regional Centre of Excellence für Robotic Technology medizintechnische Robotik voran, die künftig chirurgische Arbeit erleichtern und Patientinnen wie Patienten entlasten könnte. Beim Empfang im Palais Dverce unterstrich Bürgermeister Tomislav Tomašević den Wert des direkten Gesprächs zwischen Verwaltung und Forschung.
Fachbegriff erklärt: Katastrophenmanagement
Katastrophenmanagement bezeichnet die Gesamtheit aller Maßnahmen, mit denen Behörden, Einsatzorganisationen, Forschungseinrichtungen und Infrastrukturbetreiber auf Naturereignisse oder technische Störungen vorbereitet werden, sie bewältigen und die Folgen mindern. Dazu zählen Risikoanalysen, Frühwarnsysteme, Evakuierungs- und Versorgungskonzepte, Wiederaufbaupläne und die systematische Übung von Abläufen. Für Städte bedeutet Katastrophenmanagement nicht nur das Reagieren im Ernstfall, sondern auch das vorsorgende Planen: Gebäude werden erdbebensicherer errichtet, kritische Netze wie Strom und Wasser redundant ausgelegt und sensible Einrichtungen wie Spitäler mit Notfallprotokollen ausgestattet. Die Universität Zagreb zeigt nach den Beben 2020, wie Forschung hier praktische Lösungen schafft.
Fachbegriff erklärt: Technologietransfer
Technologietransfer ist der Weg, auf dem Erkenntnisse aus der Wissenschaft in marktfähige, anwendbare Lösungen gelangen. Er beginnt mit der Forschung an Universitäten und führt über Prototypen, Tests in Reallaboren und Pilotprojekte zur Einführung in Unternehmen oder Verwaltungen. Patente, Lizenzierungen, Spin-offs, Start-ups und Kooperationen mit der Industrie sind typische Instrumente. Für Städte ist Technologietransfer entscheidend, weil er Innovation greifbar macht: Von Robotik im medizinischen Bereich über Sensorik im Straßenraum bis zu digitalen Services für Bürgerinnen und Bürger – erst durch den Transfer entfalten Ideen Wirkung im Alltag.
Fachbegriff erklärt: Urbane Resilienz
Urbane Resilienz beschreibt die Fähigkeit einer Stadt, Erschütterungen wie Hitzewellen, Starkregen, Erdbeben oder Energiekrisen nicht nur zu überstehen, sondern sich so anzupassen, dass künftige Ereignisse weniger Schaden anrichten. Resiliente Städte planen mit grüner Infrastruktur, sorgsamer Bodenpolitik, redundanter Versorgung und krisenfesten Gebäuden. Entscheidende Bausteine sind lernende Institutionen und Partnerschaften mit Hochschulen: Wer Daten auswertet, Übungen durchführt und nach einem Ereignis systematisch verbessert, erhöht die Widerstandskraft. Resilienz ist damit ein laufender Prozess – kein Zustand, sondern eine Fähigkeit, die gepflegt und weiterentwickelt wird.
Fachbegriff erklärt: Künstliche Intelligenz in der Verwaltung
Künstliche Intelligenz in der Verwaltung umfasst datengetriebene Anwendungen, die Entscheidungen unterstützen oder Routinearbeiten automatisieren. Beispiele sind die Inspektion von Brücken mittels Bilderkennung, die Priorisierung von Anfragen in Servicezentren oder Prognosen zur Instandhaltung von Infrastruktur. Wichtig ist die Einbettung in rechtliche und ethische Leitplanken: Transparenz, Nachvollziehbarkeit und der Schutz von Grundrechten haben Vorrang. KI ersetzt keine Fachleute; sie hilft Ingenieurinnen und Ingenieuren, Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern, schneller zu bewerten, wo akuter Handlungsbedarf besteht – und schafft so Zeit für komplexe Fälle.
Fachbegriff erklärt: Supergrätzl und klimafitte Quartiere
Ein Supergrätzl ist ein städtisches Quartier, in dem der öffentliche Raum neu aufgeteilt wird: mehr Platz für Menschen, Bäume, Wasser und aktive Mobilität, weniger Durchzugsverkehr. Klimafitte Quartiere setzen auf Beschattung, Entsiegelung und Regenwassermanagement, damit Hitzebelastungen sinken und Starkregen besser aufgenommen wird. Regeln wie Mindestbaumzahlen, helle Beläge oder kühlende Oberflächen helfen, die Temperatur in Straßenzügen spürbar zu senken. Solche Vorgaben werden nicht isoliert beschlossen, sondern mit Bewohnerinnen und Bewohnern, Betrieben und der Wissenschaft abgestimmt – so entstehen Lösungen, die funktionieren und akzeptiert werden.
Historischer Kontext: Von Rotes-Wien-Tradition bis Erdbeben-Erfahrung
Wien gilt international als Vorbild für leistbares Wohnen. Die lange Tradition des geförderten Wohnbaus, die städtebauliche Qualität und die soziale Durchmischung prägen die Stadtentwicklung bis heute. Diese Erfahrung ist für europäische Partnerstädte wertvoll, die unter ähnlichen Druckfaktoren stehen: steigende Wohnkosten, wachsende Städte, Bedarf an klimaangepasster Infrastruktur. Zagreb bringt dazu eine andere Perspektive ein: Nach den schweren Erdbeben 2020 musste die Stadt nicht nur Schäden beheben, sondern die Gelegenheit nutzen, Gebäude und Viertel zukunftssicher zu planen. Universitäre Expertise in Schadensanalyse, Bautechnik und Erdbebenschutz fließt seitdem in die Praxis ein – ein Lehrbuchbeispiel für die Verbindung von Forschung und Verwaltung.
Die Vienna Science Days sind eine Plattform, auf der diese Stärken zusammenkommen. Sie werden von den Internationalen Büros der Stadt Wien getragen, die seit 1. Jänner 2016 als Unternehmen der Wien Holding arbeiten und Wiens internationale Vernetzung ausbauen. Mit Standorten in Belgrad, Berlin, Budapest, Krakau, Ljubljana, Prag, Sarajevo, Sofia und Zagreb – und direktem Draht nach Bratislava – entsteht ein Netzwerk, das Austausch beschleunigt. In einer Zeit, in der Klimawandel, Digitalisierung und demografische Veränderungen Städte parallel fordern, ist dieser Brückenschlag zentral. Aus Studien und Piloten werden so gemeinsame Standards, aus Erfahrungen umsetzbare Leitfäden.
Vergleich: Österreichs Bundesländer, Deutschland, Schweiz
Im österreichischen Kontext verbindet die Vienna-Science-Days-Agenda mehrere Baustellen, die auch andere Bundesländer umtreiben. In der Steiermark gewinnt die Anpassung an Hitze in Städten wie Graz an Bedeutung. Tirol und Salzburg fokussieren stark auf resilienten Tourismus und Schutz kritischer Infrastrukturen in alpinem Gelände. Linz und Innsbruck arbeiten an digitalen Services und Verkehrsberuhigung in dicht bebauten Zonen. Wien bringt in diese Debatte robuste Erfahrung bei geförderten Wohnungen und großstädtischem Raumdesign ein – von Supergrätzln bis zur schrittweisen Umverteilung des Straßenraums.
In Deutschland laufen ähnliche Diskussionen, etwa im Rahmen städtischer Digitalstrategien und Smart-City-Modellen. Viele Kommunen testen KI-Anwendungen in Bauaufsicht, Instandhaltung oder Bürgerdiensten. Die Herausforderung ist vergleichbar: Nutzen realisieren, Risiken minimieren. In der Schweiz geht es stark um Präzision im Vollzug und Qualität im öffentlichen Raum. Städte wie Zürich oder Basel setzen auf klare Gestaltungsvorgaben, partizipative Prozesse und robuste Infrastrukturen. Im Zusammenspiel ergibt sich ein europäischer Werkzeugkasten: Österreichische, deutsche und schweizerische Erfahrungen ergänzen sich zu praxistauglichen Bausteinen für Planung, Finanzierung und Betrieb.
Konkrete Auswirkungen für Bürgerinnen und Bürger
Was bedeutet das für den Alltag? Erstens: bessere Vorsorge. Wenn Universitäten und Verwaltungen zusammenarbeiten, entstehen Risiko- und Schadensanalysen, die etwa Schulwege, Spitalsstandorte oder Brücken gezielter absichern. Bürgerinnen und Bürger profitieren von klaren Notfallplänen und Infrastruktur, die im Ernstfall schneller wiederhergestellt wird.
Zweitens: greifbare Verbesserungen im öffentlichen Raum. Klimafitte Supergrätzl mit mehr Bäumen, Trinkbrunnen, Sitzgelegenheiten und kühlenden Flächen erhöhen die Aufenthaltsqualität. Das wirkt sich an heißen Tagen unmittelbar aus. Auch für Unternehmen entsteht ein Plus: attraktivere Geschäftsstraßen, angenehme Wege für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, berechenbare Logistik.
Drittens: effizientere Services. KI-gestützte Brückeninspektionen helfen, Wartung zu priorisieren, bevor Schäden sichtbar werden. Digitale Bürgerinnen-Services verkürzen Wege und Wartezeiten. Hier geht es nicht um Technik um der Technik willen, sondern um konkrete Ergebnisse: kürzere Prozesse, weniger Papier, klarere Auskünfte.
Viertens: leistbares Wohnen. Die Stadt Zagreb plant den Bau von 1.000 Wohnungen und arbeitet an einer langfristigen Strategie, um Druck am Wohnungsmarkt zu reduzieren. Wien teilt dazu Wissen aus Jahrzehnten des geförderten Wohnbaus – von Grundstückspolitik bis zur Qualitätssicherung im Bau. Für Haushalte bedeutet das Perspektiven: planbare Mieten, gute Anbindung, funktionierende Infrastruktur. Vertiefende Hintergründe zum Thema leistbarer Wohnraum in Wien finden Sie in unserem Dossier: Leistbares Wohnen in Wien.
Zahlen, Daten, Fakten zu den Vienna Science Days
- Datum der Konferenz: 4.–5. November 2025. Der zeitliche Fokus erlaubt, Ergebnisse unmittelbar in laufende Stadt- und Budgetplanungen einzuarbeiten. Der heutige Bericht erscheint am 11. November 2025.
- Inhalte: Klimawandel und KI in der Stadtentwicklung; Zusammenarbeit von Städten und Universitäten im Katastrophenmanagement; Technologietransfer; leistbares Wohnen.
- Universität Zagreb: Zentrale Rolle im Wiederaufbau nach den Erdbeben 2020 durch Schadensanalysen, Sanierungspläne, Risikokommunikation und moderne Erdbebenschutzmethoden.
- Beispiel Robotik: Das Regional Centre of Excellence für Robotic Technology entwickelt Systeme für den medizinischen Bereich, die künftig Chirurginnen und Chirurgen unterstützen und Patientinnen und Patienten entlasten können. Das illustriert, wie Forschung praktische Effekte erzeugt.
- Wohnbau in Zagreb: Planung von 1.000 Wohnungen als Baustein einer langfristigen Strategie gegen Marktspannung. Solche Projekte entfalten Wirkung, wenn sie mit Infrastruktur, Mobilität und Quartiersqualität verzahnt werden.
- KI in Städten: Anwendungen in Brückeninspektion und Bürgerinnen-Services zeigen, dass datenbasierte Verwaltung in Europa angekommen ist – mit dem Grundsatz, dass der Mensch im Mittelpunkt bleibt.
- Netzwerk der Internationalen Büros der Stadt Wien: Neun Standorte (Belgrad, Berlin, Budapest, Krakau, Ljubljana, Prag, Sarajevo, Sofia, Zagreb). Nähe zu Bratislava wird direkt von Wien aus gepflegt. Start als Unternehmen der Wien Holding: 1. Jänner 2016.
Die in der Quelle genannten Zahlen sind vor allem qualitativ bedeutsam: Sie zeigen, dass Projekte greifbar werden (1.000 Wohnungen), dass Expertise institutionell verankert ist (Universität Zagreb im Wiederaufbau) und dass das Netzwerk groß genug ist, um Wissen zügig zu teilen (neun internationale Verbindungsbüros). Eine Lehre daraus: Skalierung gelingt dort, wo Organisationen, Daten und Budgets aufeinander abgestimmt sind.
So funktioniert Zusammenarbeit: Von Panels zu Pilotprojekten
Die Vienna Science Days setzen stark auf den Austausch in Panels und Workshops, gefolgt von bilateralen Gesprächen. Der Empfang durch den Zagreber Bürgermeister Tomislav Tomašević im Palais Dverce half, Kontakte zu vertiefen. Solche Formate sind kein Selbstzweck: Projekte wie KI-gestützte Inspektionen oder klimafitte Straßenräume brauchen Allianzen aus Bauämtern, IT, Forschung und Betreiberinnen und Betreibern. Leitfäden, die während der Konferenz diskutiert werden, werden in Pilotvorhaben getestet und bei Erfolg ausgerollt. Das verkürzt Lernkurven und spart Kosten, weil Fehler nicht in großem Maßstab passieren.
Regeln für klimafitte Räume: Vom Baum zur Beschattung
Am Wien-Tag standen konkrete Vorgaben im Mittelpunkt, etwa für Baumpflanzungen. Das klingt simpel, hat aber weitreichende Effekte. Jede Baumart, jeder Standort, jede Baumscheibe beeinflusst, wie gut Straßen kühl bleiben und Regen versickert. Hellere Oberflächen vermindern Aufheizung; Wasserspeicher und Entsiegelung helfen, Starkregen zu puffern. Für Planerinnen und Planer bedeutet das: Standards definieren, Ausnahmen begründen, Erhalt laufend prüfen. Für die Bevölkerung bedeutet es spürbare Kühlung und bessere Luft. Hintergrundartikel zur Rolle von KI im städtischen Betrieb finden Sie hier: Künstliche Intelligenz in der Verwaltung.
Vergesst die Ethik nicht: Mensch im Mittelpunkt
So sehr Technologie lockt – am Ende zählen Rechte, Fairness und Vertrauen. Das Abschlusspanel widmete sich der Frage, wie moderne Errungenschaften gewinnbringend eingesetzt werden und gleichzeitig ethische Aspekte gewahrt bleiben. Dazu gehören transparente Prozesse, nachvollziehbare Entscheidungen und Beschwerdemöglichkeiten. Wichtig ist auch, dass Algorithmen keine Verzerrungen verfestigen. Verwaltungen in Europa setzen deshalb auf Prinzipien, die von Datenschutz über Teilhabe bis Barrierefreiheit reichen. KI wird dort stark, wo sie den Menschen dient, nicht umgekehrt.
Österreich im Netzwerk: Warum Wien als Vorbild gefragt ist
Wien gilt im Wohnbau als Referenz für langfristige Leistbarkeit und hohe Qualität. Dieses Know-how ist in Mittel- und Südosteuropa begehrt – nicht als Blaupause, sondern als Erfahrungsschatz. Die Internationalen Büros der Stadt Wien bilden dafür die Brücke: Sie machen Projekte sichtbar, schaffen Gesprächsräume und verbinden Akteurinnen und Akteure. Für Österreich bedeutet das mehr Einfluss auf europäische Standards und schnelleren Zugang zu innovativen Lösungen. Das hilft Ländern, Städten und Gemeinden – vom Viertel mit Hitzestress bis zum Tal mit sensibler Infrastruktur.
Schnittstellen zur Katastrophenvorsorge: Lernen aus Zagreb
Die Erdbeben 2020 sind für Zagreb eine Zäsur. Der Umgang damit zeigt, wie Wissenschaft und Verwaltung zusammenspielen: Gebäudebestände werden systematisch erfasst, Schäden priorisiert, Sanierungen geplant. Die Öffentlichkeit wird über Risiken informiert, damit Vorsorge zur Gemeinschaftsaufgabe wird. Für Österreichs Städte ist diese Erfahrung relevant, auch jenseits von Erdbeben: Sie lässt sich auf Starkregen, Hitze oder Energiefragen übertragen. Wer Strukturen schafft, die aus Ereignissen lernen, wird widerstandsfähiger. Weiterführende Einordnung zur Vorsorge finden Sie in unserem Hintergrund: Katastrophenschutz und Erdbebenvorsorge.
Zukunftsperspektive: Was bis 2030 realistisch ist
Für die nächsten Jahre sind drei Entwicklungen wahrscheinlich. Erstens werden Städte Partnerschaften mit Universitäten institutionalisieren: standardisierte Datenräume, gemeinsame Labs, feste Transferpfade vom Prototyp zur Anwendung. Das beschleunigt Erfolge bei Instandhaltung, Mobilität und Energie. Zweitens setzt sich der Fokus auf klimafitte Quartiere durch. Von Baumpflanzplänen über Wassermanagement bis zu hitzerobusten Materialien werden Checklisten fester Teil von Bebauungs- und Straßenprojekten. Drittens wird KI im Betrieb unspektakulär normal: weniger Pilotprojekte, mehr ruhige Routine – von der Brückenprüfung bis zur Terminvergabe. Über allem bleibt die soziale Frage: Leistbares Wohnen entscheidet, ob Transformation als Verbesserung erlebt wird. Zagreb zeigt mit 1.000 neuen Wohnungen, wie erste Entlastungen aussehen. Wien bringt Governance und Qualitätsmanagement ein, die Langfristigkeit sichern.
Fazit und Ausblick
Die Vienna Science Days in Zagreb machen deutlich, dass Europa seine urbanen Aufgaben nur im Verbund lösen kann. Wien bringt Erfahrung im leistbaren Wohnen und in der qualitätsvollen Raumgestaltung, Zagreb steuert Wiederaufbau- und Risikoexpertise bei, Universitäten liefern Methoden und Innovationen – von Robotik bis KI. Entscheidend ist, dass der Mensch im Mittelpunkt bleibt: transparente Verwaltung, faire Regeln und Räume, die den Alltag verbessern. Wer tiefer einsteigen will, findet die offizielle Aussendung hier: Vienna Science Days in Zagreb – Quelle: Stadt Wien (KOM). Pressefotos sind im Pressebereich der Wien Holding abrufbar: wienholding.at/Presse. Welche Frage zur Stadt der Zukunft beschäftigt Sie am meisten: Klimaschutz im Grätzl, digitale Services oder leistbares Wohnen? Schreiben Sie uns – wir recherchieren weiter.