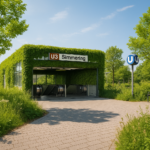Neue Daten vom 3.11.2025 zeigen: Second-Hand in Österreich wächst, Ausgaben rund 211 Euro pro Jahr. Was das für Handel und Konsum bedeutet. Der Trend zum bewussten Einkauf erreicht die breite Bevölkerung und verändert den Alltag vieler Haushalte. Der aktuelle Consumer Check des Handelsverbands, erstellt von Repubblika Research, beschreibt, wie stark Gebrauchtwaren vom Mode- bis zum Elektroniksegment an Bedeutung gewinnen. Parallel bestätigt eine Analyse der Boston Consulting Group langfristiges Wachstum im Second-Hand-Markt. Für Österreich ist das mehr als eine Randnotiz: Hierzulande haben bereits sehr viele Menschen Erfahrungen mit gebrauchten Produkten gesammelt, und die Daten deuten auf ein stabiles, nachhaltiges Plus hin. In dieser Auswertung ordnen wir die wichtigsten Zahlen ein, erklären zentrale Fachbegriffe verständlich, vergleichen die Lage in den Bundesländern und mit Nachbarländern, und zeigen, wie Bürgerinnen und Bürger sowie Händlerinnen und Händler profitieren können. Zugleich blicken wir auf Chancen für die Kreislaufwirtschaft und skizzieren realistische Perspektiven für die kommenden Jahre.
Second-Hand in Österreich: Zahlen, Fakten und Einordnung
Der Consumer Check des Handelsverbands (Quelle: Handelsverband; erhoben von Repubblika Research) macht die Dynamik deutlich. Der Second-Hand-Markt entwickelt sich laut einer Studie der Boston Consulting Group weltweit bis 2030 mit rund 10 Prozent pro Jahr – deutlich schneller als der restliche Einzelhandel. In Österreich zeigt die Befragung: 73 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher haben schon einmal Gebrauchtwaren gekauft, rund 60 Prozent in den letzten zwölf Monaten. Der durchschnittliche Einkaufswert für Second-Hand stieg gegenüber dem Vorjahr von 195 Euro auf etwa 211 Euro. Gleichzeitig planen 36 Prozent, künftig noch häufiger gebraucht einzukaufen, lediglich 7 Prozent wollen dies seltener tun.
Online-Plattformen prägen den Zugang zu Second-Hand: 55 Prozent kaufen dort regelmäßig ein. Doch auch traditionelle Formate bleiben relevant: 32 Prozent nutzten im letzten Jahr einen Flohmarkt, 31 Prozent besuchten Second-Hand- oder Vintage-Geschäfte. Beliebt sind vor allem Bekleidung für Erwachsene (38 Prozent), Bücher und Medien (33 Prozent), Spielwaren (22 Prozent), Möbel und Wohnbedarf (21 Prozent), Haushaltswaren und Geräte (19 Prozent) sowie Handys, Computer und Tablets (15 Prozent). Wichtige Motive: Produkte erhalten eine zweite Chance (74 Prozent) und der Preisvorteil gegenüber Neuware (71 Prozent).
Als Marktvolumen werden in Summe derzeit rund 2 Milliarden Euro jährlich veranschlagt. Im Bundesländer-Ranking liegen Niederösterreich und das Burgenland mit durchschnittlich 242 Euro pro Kopf vorne, gefolgt von Kärnten und Steiermark (219 Euro), Salzburg und Oberösterreich (205 Euro), Vorarlberg und Tirol (196 Euro). Wien bildet mit 190 Euro das Schlusslicht. Beim Wiederverkauf zeigt sich ebenfalls Dynamik: Drei von vier Befragten haben bereits weiterverkauft und damit im Schnitt 171 Euro pro Jahr eingenommen; 79 Prozent nutzen dafür Online-Marktplätze. Plattformen wie Willhaben, Vinted oder Refurbed spielen eine zentrale Rolle im Ökosystem.
Weiterführende Hintergründe und thematische Einordnung finden Leserinnen und Leser in verwandten Dossiers: Schwerpunkt Second-Hand, Kreislaufwirtschaft sowie Handel und Konsum. Die Originalaussendung ist hier abrufbar: OTS-Quelle des Handelsverbands.
Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze
- 73 Prozent haben bereits Second-Hand gekauft; rund 60 Prozent in den letzten zwölf Monaten.
- Durchschnittliche Ausgaben für Gebrauchtwaren: heuer etwa 211 Euro, nach 195 Euro im Vorjahr.
- 36 Prozent planen häufiger gebraucht zu kaufen, 7 Prozent seltener.
- 55 Prozent nutzen regelmäßig Online-Plattformen; 32 Prozent Flohmärkte, 31 Prozent Second-Hand-Geschäfte.
- Beliebteste Kategorien: Bekleidung, Bücher/Medien, Spielwaren, Möbel/Wohnen, Haushaltsgeräte, Elektronik.
- Hauptmotive: zweite Chance für Produkte (74 Prozent) und Preisvorteil (71 Prozent).
- Wiederverkauf: 3 von 4 verkaufen selbst; im Schnitt 171 Euro pro Jahr Einnahmen, meist über Online-Marktplätze.
- Marktvolumen: rund 2 Milliarden Euro jährlich in Österreich.
Was bedeuten zentrale Fachbegriffe?
Second-Hand-Markt
Mit Second-Hand-Markt ist der gesamte wirtschaftliche Bereich gemeint, in dem gebrauchte Güter den Besitzer wechseln. Das umfasst private Verkäufe, professionelle Händlerinnen und Händler, stationäre Second-Hand-Shops, Flohmärkte und digitale Plattformen. Der Markt verbindet Angebot und Nachfrage für Produkte, die bereits genutzt wurden, aber weiterhin funktionstüchtig sind. Er schafft Wertschöpfung durch Wiederverkauf, Aufbereitung und Logistik und reduziert gleichzeitig die Nachfrage nach neuen Ressourcen. Dadurch kann der ökologische Fußabdruck vieler Konsumgüter sinken.
Kreislaufwirtschaft
Kreislaufwirtschaft beschreibt ein Wirtschaftsmodell, in dem Produkte, Materialien und Ressourcen so lange wie möglich im Umlauf gehalten werden. Statt linearem Neuproduktion-Kauf-Entsorgung werden Güter repariert, wiederverwendet, wiederverkauft oder recycelt. Second-Hand ist ein wichtiger Baustein dieses Modells: Ein Produkt erhält eine zweite oder dritte Nutzung, was Abfall vermeidet und die Lebensdauer verlängert. Für Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet das oft niedrigere Preise, während Unternehmen neue Geschäftsmodelle wie Rücknahme und Wiederaufbereitung entwickeln können.
Re-Commerce
Re-Commerce meint den professionellen Rückkauf und Weiterverkauf gebrauchter Waren, meist über digitale Kanäle. Unternehmen nehmen Produkte zurück, prüfen Zustand und Funktion, bereiten sie auf und verkaufen sie erneut – häufig mit Gewährleistung. Für Käuferinnen und Käufer bietet Re-Commerce Transparenz über Qualität und Herkunft. Für Händlerinnen und Händler entsteht ein skalierbares, datengetriebenes Geschäft mit planbaren Prozessen. Re-Commerce senkt Hürden gegenüber rein privaten Verkäufen und stärkt das Vertrauen in Second-Hand-Angebote.
Refurbished
Refurbished bezeichnet generalüberholte Geräte, vor allem Elektronik wie Smartphones, Laptops oder Tablets. Diese Produkte wurden geprüft, gereinigt, bei Bedarf mit Ersatzteilen versehen und technisch auf einen definierten Standard gebracht. Oft gibt es eine Garantie. Für Konsumentinnen und Konsumenten ist refurbished attraktiv, weil Preis und Qualität in einem nachvollziehbaren Verhältnis stehen. Für die Umwelt bedeutet es, dass funktionsfähige Technik länger genutzt wird, wodurch Ressourcenverbrauch und Emissionen gegenüber Neuware reduziert werden können.
Online-Marktplatzplattform
Eine Online-Marktplatzplattform bringt Verkäuferinnen und Verkäufer mit Käuferinnen und Käufern zusammen, ohne selbst Eigentum an den Waren zu übernehmen. Sie stellt Infrastruktur für Inserate, Suche, Bezahlung und Versand bereit und schafft Sichtbarkeit über Regionen hinweg. Bewertungen, Käuferschutz und einfache Abwicklung senken die Hemmschwelle für den Einstieg in den Second-Hand-Handel. Dadurch wächst das Angebot, es entstehen transparente Preise, und Nischenartikel finden schneller neue Nutzerinnen und Nutzer.
Marktvolumen
Das Marktvolumen beschreibt den gesamten Wert aller Transaktionen in einem Markt innerhalb eines bestimmten Zeitraums, meist pro Jahr. Beim Second-Hand-Markt umfasst es die summierten Umsätze aus privaten Verkäufen, Plattformtransaktionen, stationären Geschäften und professionellen Re-Commerce-Anbietern. Ein Marktvolumen von rund 2 Milliarden Euro in Österreich signalisiert, dass Second-Hand längst eine relevante Größe im Einzelhandel ist. Es bildet eine wichtige Grundlage, um Investitionen, Geschäftsmodelle und Arbeitsplätze in diesem Segment zu planen.
Vom Flohmarkt zur Plattformökonomie: ein kurzer historischer Kontext
Second-Hand hat in Österreich eine lange Tradition. Flohmärkte, Altwarenhandlungen und Tauschbörsen prägen seit Jahrzehnten das Bild in Städten und Gemeinden. Was früher oft als Sparmaßnahme oder Liebhaberei für Raritäten galt, hat sich mit der Digitalisierung zum breiten Massenphänomen entwickelt. Der Übergang von analogen Marktplätzen zu digitalen Plattformen beschleunigte den Zugang: Statt lokaler Reichweite sind heute regionale und nationale Märkte nur wenige Klicks entfernt. Das senkt Transaktionskosten, macht Preise vergleichbar und schafft Vertrauen durch Bewertungen.
Dazu kommt ein gesellschaftlicher Wertewandel. Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung werden im Alltag sichtbarer, was das Interesse an langlebigen, reparierbaren und wiederverwendbaren Produkten steigert. Second-Hand profitiert davon unmittelbar. Gleichzeitig professionalisieren Händlerinnen und Händler ihre Angebote: standardisierte Qualitätsprüfungen, klar definierte Zustandsklassen und Garantieversprechen erhöhen die Planungssicherheit beim Kauf. Insgesamt hat sich Second-Hand von einer Nische zu einem festen Bestandteil des modernen Konsums entwickelt – mit wachsender Bedeutung für Handel und Haushalte.
Bundesländer im Vergleich – und der Blick nach Deutschland und in die Schweiz
Die ausgewiesenen Pro-Kopf-Ausgaben zeigen regionale Unterschiede. Niederösterreich und Burgenland führen mit durchschnittlich 242 Euro pro Jahr, gefolgt von Kärnten und Steiermark mit 219 Euro. Salzburg und Oberösterreich liegen bei 205 Euro, Vorarlberg und Tirol bei 196 Euro. Wien kommt auf 190 Euro pro Kopf. Solche Differenzen können viele Gründe haben, etwa unterschiedliche Angebotsdichte an Plattformnutzerinnen und -nutzern, die Präsenz stationärer Second-Hand-Shops, sozioökonomische Strukturen oder das lokale Preisniveau. Entscheidend ist: In allen Regionen ist Second-Hand etabliert, die Ausgaben bewegen sich auf beachtlichem Niveau.
Im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz zeigen sich ähnliche Grundmuster. In beiden Ländern haben digitale Marktplätze Second-Hand stark vereinfacht; Mode, Medien und Elektronik gehören zu den gefragten Kategorien. Zudem professionalisieren Händlerinnen und Händler das Re-Commerce-Geschäft mit klaren Zustandsangaben und Garantien. Unterschiede ergeben sich vor allem aus nationalen Rahmenbedingungen, etwa Konsumgewohnheiten, Einkommen, Preissetzung und landesspezifischen Handelsstrukturen. Österreich bewegt sich innerhalb dieses DACH-Vergleichs auf einem Pfad, der eine wachsende Akzeptanz und zunehmende Nutzung quer durch die Bevölkerung erkennen lässt.
Konkrete Auswirkungen für Bürgerinnen und Bürger
Für Haushalte eröffnet Second-Hand mehrere Vorteile. Erstens schafft es finanziellen Spielraum: Wer Bücher, Kleidung oder Haushaltsgeräte gebraucht kauft, kann die Ausgaben senken. Ein Beispiel: Eine Familie stattet die Kinder mit gebrauchter Winterbekleidung aus, ergänzt das Kinderzimmer mit einem Second-Hand-Schreibtisch und kauft ein generalüberholtes Tablet für die Schule. In Summe bleibt mehr Budget für Energie, Miete oder Freizeit. Zweitens stärkt Second-Hand die Unabhängigkeit: Wenn ein Gerät kurzfristig benötigt wird, kann ein gebrauchtes Modell schnell und günstig verfügbar sein.
Drittens profitieren viele vom Wiederverkauf. Wer den Kleiderschrank ausmistet, Spielzeug weitergibt oder ein Smartphone veräußert, erzielt Einnahmen und schafft Platz. Mit durchschnittlich 171 Euro pro Jahr aus Verkäufen lassen sich kleinere Anschaffungen querfinanzieren. Viertens fördert Second-Hand Kompetenzen: Preisvergleich, Qualitätsprüfung und Produktkenntnis werden zur Routine. Das stärkt eine informierte Konsumkultur. Schließlich hat Second-Hand ökologische Effekte: Produkte erhalten eine zweite Chance, was Ressourcenverbrauch und Abfall mindern kann. So verbinden sich Preisvorteile und Nachhaltigkeit zu einem schlüssigen Alltagsmodell.
Zahlen und Fakten vertieft analysiert
Die Steigerung der durchschnittlichen Ausgaben von 195 auf etwa 211 Euro entspricht einem Plus von rund acht Prozent. Das ist beachtlich, weil es nicht nur mehr Käuferinnen und Käufer gibt, sondern auch intensivere Nutzung pro Person. Gleichzeitig planen 36 Prozent, künftig noch häufiger gebraucht einzukaufen – ein deutliches Signal für weiteres Wachstum. Der Anteil von 18 Prozent, die mindestens einmal im Monat Second-Hand erwerben, deutet auf eine stabile Kernnutzerschaft hin, die den Markt laufend belebt und Angebotsvielfalt sowie Preisbildung prägt.
Die Rolle der Plattformen ist zentral: 55 Prozent kaufen regelmäßig online, was Reichweite und Auswahl erhöht. Flohmärkte (32 Prozent) und Second-Hand- bzw. Vintage-Geschäfte (31 Prozent) bleiben jedoch wichtige Kanäle, insbesondere für Menschen, die Ware haptisch begutachten möchten oder den lokalen Austausch schätzen. Bei den Kategorien führen Bekleidung (38 Prozent) und Medien (33 Prozent); Elektronik liegt mit 15 Prozent ebenfalls im relevanten Bereich. Die Motive sind klar: 74 Prozent wollen Produkten eine zweite Chance geben, 71 Prozent sehen den Preisvorteil als wesentliches Argument. Diese Kombination aus Werteorientierung und praktischer Ersparnis erklärt, warum Second-Hand sowohl Kopf als auch Geldbörse anspricht.
Das ausgewiesene Marktvolumen von rund 2 Milliarden Euro pro Jahr zeigt die wirtschaftliche Relevanz. Es bildet einen wachsenden Teil des Einzelhandels ab und eröffnet dem stationären Handel neue Modelle. 70 Prozent der Befragten würden Second-Hand-Zonen im Geschäft begrüßen, 72 Prozent sind an generalüberholten Produkten interessiert. Das verweist auf hybride Angebote: Kundinnen und Kunden kaufen vor Ort, lassen sich beraten und nutzen gleichzeitig digitale Services wie integrierte Resale-Optionen.
Auch der Wiederverkauf ist ein Treiber. Drei von vier Österreicherinnen und Österreichern haben bereits verkauft, meist Kleidung/Schuhe (45 Prozent), Bücher/Medien (43 Prozent) oder Haushaltswaren (39 Prozent). 79 Prozent nutzen Online-Marktplätze – logisch, weil Sichtbarkeit, Abwicklung und Preisfindung dort besonders effizient sind. Diese Zahlen sprechen für ein Ökosystem, in dem Kauf und Verkauf einander verstärken: Wer verkauft, kauft oft auch wieder – ein Kreislauf, der Konsumkosten senkt und Produktlebensdauern verlängert.
Chancen für den stationären Handel
Der Handel kann Second-Hand in bestehende Flächen integrieren: Rücknahmesysteme, geprüfte Gebrauchtwarenzonen und Kooperationen mit Re-Commerce-Dienstleistern senken Hürden für die Kundschaft. Laut der Erhebung befürworten 70 Prozent entsprechende Angebote, 72 Prozent interessieren sich für generalüberholte Ware, etwa von spezialisierten Anbietern. Handelssprecher Rainer Will bringt es auf den Punkt: „Der stationäre Einzelhandel hat hier enormes Potenzial, vom Rücknahmesystem bis hin zu integrierten Gebrauchtwarenzonen. Wer heute auf Gebrauchtmodelle setzt, investiert in die Zukunft – für die Kundinnen und Kunden und die Umwelt.“
Zukunftsperspektive: Wie sich der Second-Hand-Markt entwickeln kann
Die Kombination aus Wertewandel, digitaler Infrastruktur und Preisbewusstsein spricht dafür, dass Second-Hand weiter wächst. Wenn 36 Prozent häufiger gebraucht kaufen wollen und 18 Prozent bereits monatlich einkaufen, entsteht ein robuster Nachfragekern. Perspektivisch dürften Qualitätsstandards, Zustandsklassen und Garantien an Bedeutung gewinnen, um Kaufentscheidungen zu vereinfachen. Für den stationären Handel bieten sich hybride Konzepte an: persönliche Beratung, Inzahlungnahme, digitale Angebotsanzeigen und lokal verfügbare, geprüfte Produkte.
Auch die Rolle von generalüberholten Geräten wird zunehmen. Refurbished-Elektronik erschließt Zielgruppen, die Funktionssicherheit und Garantie schätzen, aber den Neupreis vermeiden möchten. Für die Kreislaufwirtschaft bedeutet das: Mehr Produkte bleiben länger im Umlauf, Reparatur und Aufbereitung werden attraktiver. Voraussetzung sind klare Informationen, faire Preise und verlässliche Abwicklungsprozesse. Mit zunehmender Routine im Wiederverkauf wird Second-Hand ein selbstverständlicher Bestandteil des Konsumalltags – vom Modekauf bis zur Wohnraumausstattung.
Fazit und nächste Schritte
Der aktuelle Datenstand vom 3.11.2025 zeigt: Second-Hand ist in Österreich etabliert und wirtschaftlich relevant. Mehr Käuferinnen und Käufer, höhere durchschnittliche Ausgaben und klare Motive stärken den Markt. Digitale Plattformen treiben die Reichweite, stationäre Angebote sichern Nähe und Vertrauen. Für Haushalte bedeutet Second-Hand Sparpotenzial, flexible Beschaffung und ökologische Vorteile. Für den Handel eröffnen sich neue Service- und Geschäftsmodelle, vom Rücknahmesystem bis zum Re-Commerce-Partner.
Wer tiefer einsteigen möchte, findet Hintergründe im Second-Hand-Schwerpunkt, in Analysen zur Kreislaufwirtschaft und in Berichten zum Handel. Die Originalquelle ist hier abrufbar: Handelsverband via OTS. Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen mit Second-Hand: Welche Kategorie hat Sie zuletzt überzeugt – und warum? Oder planen Sie, künftig häufiger gebraucht zu kaufen? Ihre Praxisbeispiele helfen, den Trend besser zu verstehen und Serviceangebote weiterzuentwickeln.