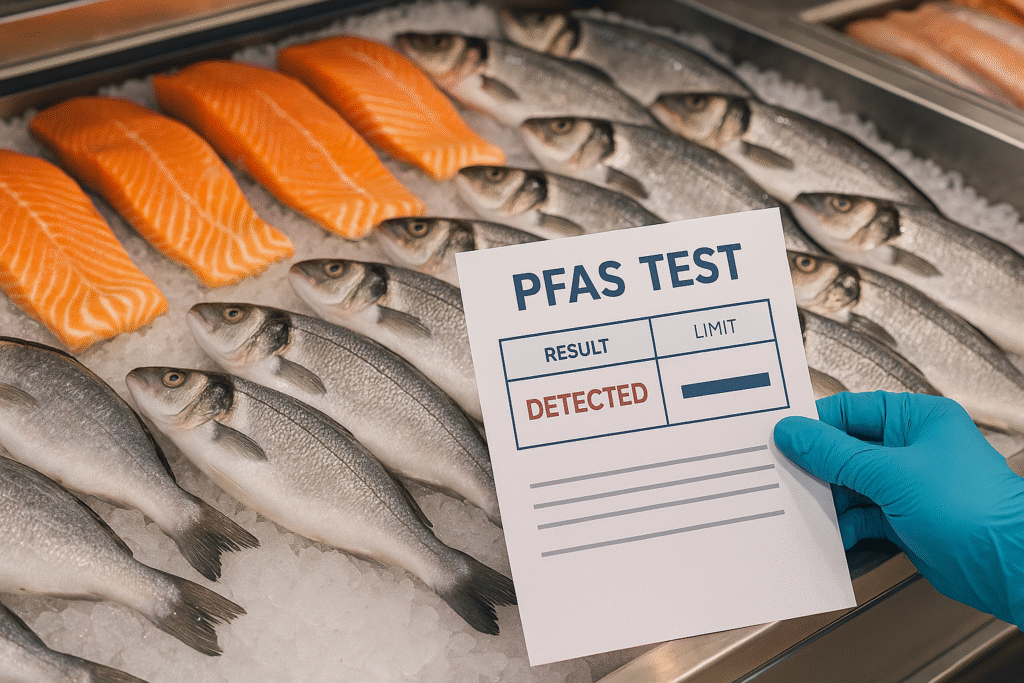Österreich diskutiert schärfere Regeln für PFAS, während große Handelsketten handeln: Am 13.11.2025 bestätigen neue Recherchen, dass MPreis, Metro und Transgourmet regelmäßige PFAS-Tests für ihr Fischsortiment einführen. Der Schritt folgt auf einen Greenpeace-Test, der belastete Proben aus Nord- und Ostsee publik gemacht hat. Für Konsumentinnen und Konsumenten ist das Thema mehr als abstrakt: Mehrere tausend Tonnen Nordseefisch landen laut Antworten der Unternehmen jedes Jahr auf österreichischen Tellern. Was das für Familien, Gastronomiebetriebe und die Lebensmittelaufsicht bedeutet, warum die Restaurantkette Nordsee laut Greenpeace keine Auskunft gibt und welche europäischen Regelungen jetzt entscheidend werden könnten, ordnen wir ein – faktenbasiert, ohne Alarmismus, mit Blick auf die österreichische Situation.
PFAS-Tests im Fischsortiment: Was jetzt gilt und warum es Österreich betrifft
Greenpeace hat in einer aktuellen Aussendung (Quelle: OTS/Greenpeace) berichtet, dass MPreis sowie die Großhändler Metro und Transgourmet künftig regelmäßige PFAS-Tests für ihr Fischsortiment durchführen. Hofer prüft ein entsprechendes Programm. Bereits länger testen SPAR, Billa (REWE-Gruppe), Lidl und der Lebensmittelkonzern Iglo ihre Fischprodukte auf PFAS. Laut Greenpeace verweigerte die Restaurantkette Nordsee jede Auskunft zu Prüfungen. Die Umweltschutzorganisation fordert zudem von der Bundesregierung ein rasches Verbot aller PFAS-Chemikalien, um die Einträge in Umwelt und Nahrungskette langfristig zu stoppen.
Hintergrund ist ein im Oktober 2025 beauftragter Labortest von Greenpeace, demzufolge alle 18 untersuchten Proben von Speisefischen, Muscheln und Krabben aus Nord- und Ostsee mit PFAS belastet waren. Etwa die Hälfte sei so stark kontaminiert gewesen, dass sie für Kleinkinder nicht sicher gewesen wäre. Unklar blieb, welcher Anteil dieser Fänge tatsächlich in Österreich verkauft wird; laut den Antworten der Unternehmen dürften es mehrere tausend Tonnen Nordseefisch pro Jahr sein, exakte Zahlen sind wegen lückenhafter Angaben jedoch nicht möglich.
Fachbegriffe verständlich erklärt
PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen): PFAS ist eine Sammelbezeichnung für mehrere tausend synthetische Chemikalien, die aufgrund ihrer wasser-, fett- und schmutzabweisenden Eigenschaften in zahlreichen Produkten eingesetzt wurden und werden, etwa in Outdoor-Bekleidung, Kochgeschirr mit Antihaftbeschichtung, Löschschäumen oder bestimmten Verpackungen. Das Problem: Viele PFAS sind extrem langlebig, bauen sich in der Umwelt kaum ab und können sich in Organismen anreichern. Deswegen werden sie in der Debatte oft als „Ewigkeitschemikalien“ bezeichnet. Für Laien wichtig: PFAS ist kein einheitlicher Stoff, sondern eine ganze Stoffklasse – mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften. Genau diese Vielfalt erschwert Regulierung, Messung und Kontrolle.
Grenzwerte: In der Risikobewertung von Lebensmitteln spielen Grenzwerte eine zentrale Rolle. Ein Grenzwert ist eine behördlich festgelegte Konzentration eines Stoffes, die in einem Produkt nicht überschritten werden darf. Für PFAS existieren je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Regelungsansätze: etwa Summengrenzwerte für Gruppen ausgewählter PFAS in Trinkwasser oder in bestimmten Lebensmittelkategorien. Für Konsumentinnen und Konsumenten ist relevant, dass Grenzwerte auf wissenschaftlichen Bewertungen beruhen, die Sicherheitsmargen einkalkulieren. Sie sind dynamisch: Wenn neue Daten hinzukommen, können sie angepasst werden. Dabei geht es um Risikominimierung, nicht um die Vorstellung einer absoluten Null-Belastung.
Bioakkumulation: Unter Bioakkumulation versteht man die Anreicherung von Stoffen in lebenden Organismen im Laufe der Zeit. Bei PFAS ist das brisant, weil sie in Gewässern vorhanden sein können und sich entlang der Nahrungskette anreichern: Plankton nimmt Spuren auf, kleine Fische fressen Plankton, größere Fische fressen kleinere – und am Ende steht der Mensch. Für Laien bedeutet das: Selbst wenn die Konzentration im Wasser gering ist, kann sie im Fischgewebe höher ausfallen. Das ist einer der Gründe, warum PFAS im Meeresfisch immer wieder nachgewiesen werden und warum regelmäßige Tests sinnvoll sind.
Lieferkette: Die Lieferkette beschreibt den Weg eines Produkts vom Fang oder der Produktion bis ins Verkaufsregal oder auf den Teller. Beim Fisch umfasst das den Fang in Fanggebieten (z. B. Nordsee), die Verarbeitung (Filetierung, Tiefkühlung), den Transport, die Zwischenlagerung und die Kontrolle durch Anbieterinnen und Anbieter sowie Behörden. Für PFAS bedeutet das: Selbst wenn der Fisch aus einer bestimmten Region stammt, ist die Prüftiefe entscheidend. Handel und Großhandel können durch eigene Monitoringprogramme entlang dieser Kette an unterschiedlichen Punkten testen und auffällige Chargen zurückhalten oder vom Einkauf ausschließen.
Monitoringprogramm: Ein Monitoringprogramm ist ein systematischer, wiederholter Prüfplan mit definierten Probenahmen, Analysemethoden und Grenzwertbezügen. Im Kontext des Lebensmitteleinzelhandels bedeutet das: Unternehmen legen fest, welche Fischarten, Herkünfte und Chargen in welchem Intervall untersucht werden, welche Labore welche PFAS-Substanzen nach standardisierten Methoden messen und wie mit Überschreitungen verfahren wird. Für die Öffentlichkeit ist wichtig: Solche Programme schaffen Transparenz und Nachvollziehbarkeit – sie sind ein Baustein, um Risiken zu reduzieren, und ergänzen die amtliche Lebensmittelkontrolle.
Vorsorgeprinzip: Das Vorsorgeprinzip ist ein Leitgedanke der europäischen Umwelt- und Gesundheitspolitik. Es besagt, dass potenziell schädliche Einwirkungen frühzeitig und präventiv begrenzt werden sollen, auch wenn wissenschaftlich noch nicht alle Details abschließend geklärt sind. Auf PFAS übertragen heißt das: Weil diese Stoffe sehr langlebig sind, schwer abbaubar und sich akkumulieren können, spricht viel dafür, Belastungen an der Quelle zu minimieren – etwa durch Verbote bestimmter Anwendungen, strenge Grenzwerte und gezielte Kontrollen. Das Ziel ist, die langfristige Exposition von Bevölkerung und Umwelt zu senken.
Zahlen, Fakten und Einordnung für Österreich
Die zentralen, öffentlich kommunizierten Fakten aus der Greenpeace-Aussendung sind klar umrissen: Alle 18 getesteten Proben von Speisefischen, Muscheln und Krabben aus Nord- und Ostsee wiesen PFAS auf; ungefähr die Hälfte wurde für Kleinkinder als nicht sicher eingestuft. Im österreichischen Handel reagieren mehrere große Akteure: MPreis, Metro und Transgourmet führen regelmäßige Tests ein; Hofer prüft die Einführung. SPAR, Billa (REWE), Lidl und Iglo testen bereits. Laut Greenpeace verweigerte die Restaurantkette Nordsee jede Auskunft. Zugleich ergaben die Rückmeldungen der Unternehmen, dass jährlich mehrere tausend Tonnen Nordseefisch in Österreich konsumiert werden; eine präzisere Schätzung ist aufgrund lückenhafter Angaben nicht möglich.
- 18 von 18 Proben belastet (Quelle: Greenpeace-Test, Oktober 2025)
- Rund 50 Prozent der Proben für Kleinkinder nicht sicher
- Neue Testprogramme: MPreis, Metro, Transgourmet
- Bestehende Testprogramme: SPAR, REWE (Billa Plus, Billa, Penny), Lidl, Iglo
- Hofer: Prüfung eines Programms im Gange
- Nordsee: laut Greenpeace keine Auskunft
- Mehrere tausend Tonnen Nordseefisch in Österreichs Konsum, genaue Zahl unklar
Diese Fakten geben eine klare Richtung vor: Der österreichische Handel reagiert mit einem Instrumentarium, das kurzfristig für mehr Produktsicherheit sorgen kann – nämlich systematische PFAS-Tests. Für die Politik bleibt die Frage einer übergeordneten Regulierung, etwa eines EU-weiten Verbots ganzer PFAS-Stoffgruppen, wie es Greenpeace fordert. Darüber hinaus verweist Greenpeace auf mögliche nationale Maßnahmen: Verbote von PFAS in Verpackungen, Kosmetika und Kleidung sowie niedrigere Grenzwerte, wie sie in Frankreich und Dänemark bereits gelten.
Historische Entwicklung: Von Nischenchemikalie zur Regulierungsspirale
PFAS wurden ab der Mitte des 20. Jahrhunderts breit industriell genutzt. Die Faszination lag in ihren Eigenschaften: Sie sind hitzestabil, chemisch widerstandsfähig, wasser- und fettabweisend. So fanden sie ihren Weg in Outdoor-Bekleidung, in die Oberflächen von Pizzakartons, in Teppiche und Löschschäume. Lange Zeit galten PFAS als technische Problemlöser. Mit zunehmender wissenschaftlicher Evidenz wuchsen jedoch die Bedenken: Untersuchungen zeigten, dass manche PFAS im Blut von Menschen und Wildtieren weltweit nachweisbar sind. Auch in Sedimenten und Böden weisen Studien auf die Langlebigkeit hin. In Europa wurde daraufhin der regulatorische Druck größer – einzelne PFAS wurden beschränkt oder verboten, und es etablierte sich die Einsicht, dass der Ansatz „Stoff für Stoff“ bei tausenden Varianten an seine Grenzen stößt.
In Österreich ist die PFAS-Debatte verknüpft mit Themen wie Trinkwasserqualität, Altlastensanierung und Lebensmittelsicherheit. Behörden, Länder und Gemeinden mussten in den letzten Jahren punktuell prüfen, wo PFAS vorkommen und wie sie begrenzt werden können – ein Prozess, der in vielen EU-Mitgliedstaaten ähnlich verlief. Die Aufmerksamkeit für Meeresfisch ist Teil dieses größeren Bildes: Sie zeigt, dass PFAS über Umweltpfade in die Nahrung gelangen und dass Verbraucherschutz nicht nur eine Frage der heimischen Produktion ist, sondern auch des internationalen Warenverkehrs. Der aktuelle Schritt des Handels, Tests zu etablieren oder zu verstetigen, ist vor diesem Hintergrund ein Baustein einer länger laufenden Entwicklung hin zu Vorsorge und Transparenz.
Vergleiche: Österreich, Deutschland, Schweiz – und der Blick in die EU
Österreich ist in den Lebensmittelregelungen eng mit dem EU-Recht verwoben. Für PFAS bedeutet das: Wenn europäische Grenzwerte, Verbote oder Beschränkungen kommen, gelten sie grundsätzlich in allen Mitgliedstaaten. Die Diskussion um eine umfassende EU-Beschränkung ganzer PFAS-Gruppen läuft seit Jahren. Österreichische Interessenverbände und NGOs wie Greenpeace drängen auf rasches Handeln, um Expositionen zu senken. Gleichzeitig setzt der Handel – wie die aktuellen Testprogramme zeigen – eigene Maßnahmen um. In Deutschland ist die Debatte ähnlich gelagert: Auch dort stehen PFAS im Fokus von Umwelt- und Verbraucherbehörden, und große Handelsketten haben Prüfprogramme für sensible Produktgruppen etabliert. Die Schweiz, die nicht EU-Mitglied ist, orientiert sich häufig an EU-Standards oder arbeitet an eigenen, zum Teil vergleichbaren Regelungen, insbesondere bei Lebensmitteln und Trinkwasser.
Ein weiterer Vergleich betrifft einzelne europäische Länder mit strengeren Vorgaben in bestimmten Bereichen. Greenpeace verweist auf Frankreich und Dänemark, wo bereits niedrigere PFAS-Grenzwerte und Verbote in Verpackungen, Kosmetika und Teilen der Textilbranche umgesetzt wurden. Für Österreich ist das ein Referenzpunkt: Nationale Maßnahmen sind möglich, selbst wenn EU-Entscheidungen noch ausstehen. Wichtig ist, dabei die heimischen Kontrollstrukturen mitzudenken: Lebensmittelaufsicht in den Bundesländern, Zusammenarbeit mit akkreditierten Laboren sowie klare Kommunikation gegenüber Konsumentinnen und Konsumenten.
Was bedeutet das für Bürgerinnen und Bürger? Konkrete Auswirkungen
Für Haushalte in Österreich hat die Nachricht mehrere Folgen. Erstens steigt die Transparenz im Fischregal: Wenn MPreis, Metro und Transgourmet regelmäßige PFAS-Tests etablieren und andere Anbieter bereits testen, dürfte die Wahrscheinlichkeit sinken, dass stark belastete Chargen in den Verkauf gelangen. Zweitens hilft die klare Kommunikation von Testergebnissen – soweit rechtlich und wettbewerblich möglich – Familien mit Kleinkindern bei der Risikoabwägung. Denn laut Greenpeace waren rund 50 Prozent der untersuchten Proben aus Nord- und Ostsee für Kleinkinder nicht sicher; hier braucht es Orientierung und gegebenenfalls den Hinweis auf alternative Herkunft, Artenwahl oder Verarbeitungsformen.
Für die Gastronomie, insbesondere für Betriebe, die Fischgerichte als Kernangebot führen, sind verlässliche Liefernachweise wichtig. Großhändler wie Metro und Transgourmet, die nun testen, senden ein Signal in Richtung Küchenchefinnen und Küchenchefs: Warensicherheit wird messbar. In Betrieben kann das zu internen Standards führen, etwa zu Einkaufsvorgaben, die geprüfte Ware bevorzugen. Für die öffentliche Beschaffung – Kantinen, Spitäler, Schulen – könnten solche Programme als Best Practice dienen.
Für Konsumentinnen und Konsumenten ist drittens relevant, wie mit Befunden umgegangen wird. Ein Monitoringprogramm allein löst das PFAS-Problem nicht; es schafft aber die Voraussetzung, Auffälligkeiten rasch zu erkennen und zu handeln. Wenn Unternehmen belastete Chargen identifizieren, können sie diese auslisten, Lieferanten wechseln oder strengere Anforderungen in Verträgen verankern. Langfristig stärkt das das Vertrauen in die Lieferkette.
Wie sich die Zahlen einordnen lassen
Die Zahl „18 von 18 Proben belastet“ klingt alarmierend, ist aber in der PFAS-Debatte nicht überraschend, weil viele PFAS in der Umwelt sehr persistent sind. Entscheidend für die Risikobewertung ist die Höhe der Belastung und der Verzehrkontext. Dass rund die Hälfte der Proben für Kleinkinder nicht sicher war, unterstreicht die besondere Schutzbedürftigkeit dieser Gruppe. Eltern profitieren daher von klaren Empfehlungen und von Handelsmaßnahmen, die das Risiko an der Quelle senken. Die Größenordnung „mehrere tausend Tonnen Nordseefisch pro Jahr“ in Österreich deutet auf die Relevanz des Themas für die heimische Ernährung hin, auch wenn eine genaue Zahl aus Unternehmensangaben derzeit nicht ableitbar ist.
Rechtlicher Rahmen und Rolle der Politik
Die Forderung von Greenpeace nach einem umfassenden Verbot aller PFAS zielt auf eine Quelle- statt End-of-Pipe-Strategie: Wenn bestimmte Anwendungen nicht mehr erlaubt sind, gelangen weniger PFAS in die Umwelt und letztlich in die Nahrung. In der EU werden seit längerem weitreichende Beschränkungen diskutiert. Für Österreich ergibt sich daraus eine doppelte Spur: Zum einen die Mitgestaltung auf EU-Ebene, zum anderen nationale Maßnahmen, etwa Verbote in Verpackungen, Kosmetika und Kleidung sowie strengere Grenzwerte, wie sie Greenpeace als an Frankreich und Dänemark orientiert beschreibt. Wichtig ist dabei eine evidenzbasierte Bewertung und ein abgestimmtes Vorgehen mit Vollzug und Kontrollen.
Die Lebensmittelaufsicht in Österreich liegt bei den Bundesländern, koordiniert durch den Bund. Prüfprogramme des Handels sind eine sinnvolle Ergänzung, ersetzen aber nicht amtliche Kontrollen. Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit – im Rahmen des medien- und wettbewerbsrechtlich Zulässigen – bleibt ein Schlüsselfaktor für Vertrauen. Wo Unternehmen sich wie in diesem Fall proaktiv auf Tests verständigen, kann die Politik die Rahmenbedingungen so gestalten, dass gute Praxis skaliert, etwa durch Leitfäden, Audits und Förderungen für Umstellungskosten bei Lieferketten.
Expertenstimme aus der Quelle
Aus der vorliegenden Quelle wird Sebastian Theissing-Matei, Sprecher von Greenpeace Österreich, zitiert: Er begrüßt die Reaktion des Handels auf „besorgniserregende PFAS-Funde“ und kritisiert, dass ausgerechnet die Restaurantkette Nordsee keine Auskunft geben wolle, ob ihre Fische geprüft werden. Diese Aussage ordnen wir ausdrücklich als Position von Greenpeace ein. Unternehmen, die keine Auskunft geben, verletzen damit nicht automatisch rechtliche Pflichten; sie setzen jedoch ein Signal in einer sensiblen Debatte, in der Transparenz öffentlich eingefordert wird.
Praxisnah: Was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun?
- Auf Herkunft und Anbieter achten: Wo verfügbar, Informationen zu Fanggebiet und Prüfprogrammen nutzen.
- Abwechslung in der Ernährung: Unterschiede zwischen Arten, Herkünften und Verarbeitungsformen berücksichtigen.
- Informationen der Behörden verfolgen: Einschätzungen der Lebensmittelaufsicht und Verbraucherschutzstellen einbeziehen.
- Nachfragen stellen: Händlerinnen und Händler sowie Gastronomiebetriebe um Auskunft zu Prüfstandards bitten.
Nützlich sind darüber hinaus Berichte und Dossiers, die Hintergründe bündeln. Verwandte Themen finden Leserinnen und Leser bei unseren Analysen zu PFAS und Lebensmittelsicherheit, zu Trinkwasserfragen und zu Verpackungsregulierung.
Interne Verlinkungen für vertiefende Lektüre
Weiterlesen auf Pressefeuer.at: PFAS in Lebensmitteln: Fragen und Antworten, Lebensmittelkontrollen in Österreich: Zuständigkeiten und Praxis, PFAS im Trinkwasser: Wo steht Österreich?
Zukunftsperspektive: Was ist in den nächsten 12–24 Monaten zu erwarten?
Die unmittelbare Folge der aktuellen Entwicklung ist ein dichteres Netz an Prüfungen im Handel. Für die kommenden 12 bis 24 Monate ist realistisch, dass sich Monitoringprogramme verfeinern: Auswahl der PFAS-Analyten wird erweitert, Probenpläne werden risikobasiert, und Ergebnisse fließen stärker in Einkaufsentscheidungen ein. Großhändlerinnen und Großhändler, die Gastronomie beliefern, könnten Prüfanforderungen vertraglich festschreiben und so Anreize in der vorgelagerten Lieferkette setzen. Auf politischer Ebene ist zu erwarten, dass EU-Beratungen zu PFAS-Beschränkungen weitergehen und nationale Debatten – insbesondere zu Verpackungen, Kosmetika und Textilien – Fahrt aufnehmen. Österreich könnte, angelehnt an Frankreich und Dänemark, einzelne Maßnahmen vorziehen, falls EU-Regelungen noch Zeit benötigen.
Für Konsumentinnen und Konsumenten dürften zwei Entwicklungen spürbar werden: Erstens mehr Kommunikation im Handel über geprüfte Ware – etwa über Label oder Kundeninformationen. Zweitens eine wachsende Rolle von Beratung: Ernährungsinformationen, Empfehlungen für besonders sensible Gruppen wie Kleinkinder und Schwangere sowie alltagsnahe Tipps zur Produktauswahl. Wichtig bleibt: PFAS sind ein Langfristthema. Selbst bei raschem regulatorischem Fortschritt wird es dauern, bis Altlasten in Umwelt und Lieferketten spürbar abnehmen. Die aktuellen Schritte des Handels sind daher als Signal zu verstehen, dass Risikominimierung heute beginnt – begleitet von Wissenschaft, Behörden und informierten Kaufentscheidungen.
Transparenz, Quellen und rechtliche Hinweise
Dieser Beitrag basiert ausschließlich auf der am 13.11.2025 veröffentlichten Aussendung von Greenpeace (OTS) und den darin enthaltenen Angaben. Zentrale Quellen: OTS-Pressemeldung von Greenpeace, der Verweis auf den PFAS-Test von Speisefisch (Oktober 2025) sowie Bildmaterial-Hinweise unter act.gp/3IE9P6i. Aussagen zu Testeinführungen, bestehenden Programmen und der Auskunftsverweigerung der Restaurantkette Nordsee sind als Darstellung der Umweltschutzorganisation wiedergegeben. Eine weitergehende Bewertung einzelner Unternehmen erfolgt nicht.
Hinweis zu Gesundheit und Risiko
Dieser Artikel ersetzt keine individuelle Ernährungsberatung. Für konkrete Empfehlungen wenden Sie sich bitte an Ärztinnen und Ärzte oder staatliche Beratungsstellen. Die Bewertung der Lebensmittelsicherheit obliegt den zuständigen Behörden. Unternehmen entscheiden eigenverantwortlich über zusätzliche Prüfprogramme und deren Kommunikation.
Schluss: Österreich zwischen Marktinitiative und Regulierung
Österreich erlebt bei PFAS in Fischprodukten eine doppelte Bewegung: Der Handel professionalisiert seine Kontrollen, die Politik berät über strengere Regeln. Auslöser waren klare Testbefunde: 18 von 18 Proben aus Nord- und Ostsee waren belastet, etwa die Hälfte für Kleinkinder nicht sicher. Daraus folgt kein Alarmismus, aber Handlungsbedarf. MPreis, Metro und Transgourmet gehen voran; SPAR, Billa, Lidl und Iglo sind bereits unterwegs; Hofer prüft. Nordsee hat laut Greenpeace keine Auskunft gegeben. Nächste Schritte sollten Transparenz, risikobasiertes Monitoring und evidenzbasierte Regulierung verbinden – mit besonderem Schutz für Kinder. Leserinnen und Leser sind eingeladen, informierte Fragen an Handel und Gastronomie zu stellen und die weitere Debatte konstruktiv zu begleiten.
Mehr Hintergründe, Checklisten und Analysen finden Sie in unseren Dossiers: PFAS in Lebensmitteln, Lebensmittelkontrollen und PFAS im Trinkwasser.