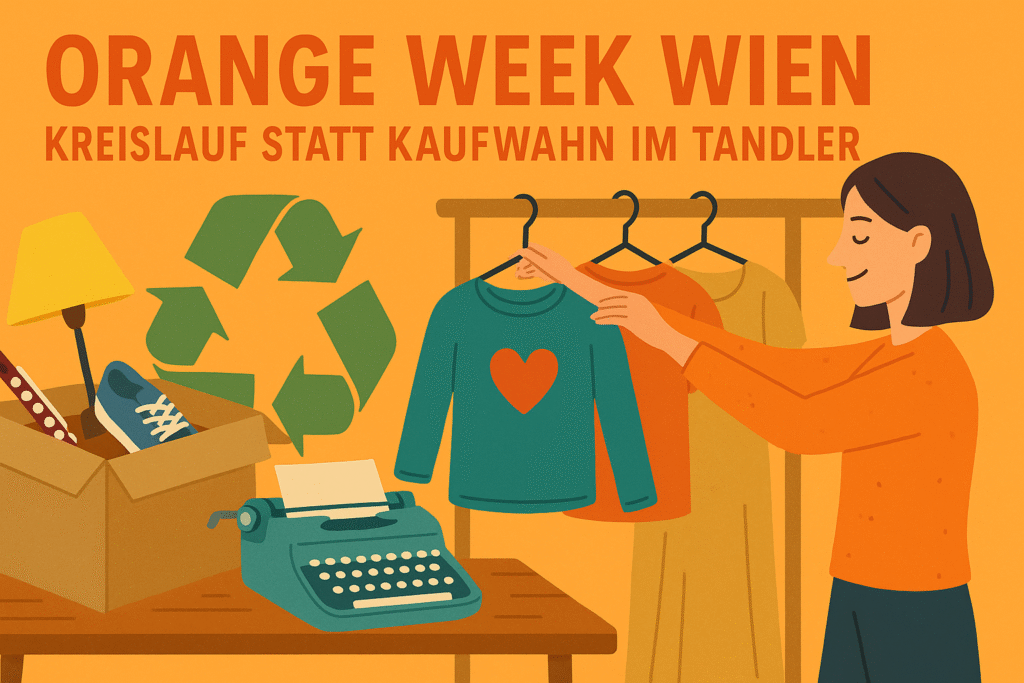Wien setzt am 21. November 2025 ein Zeichen: Die Orange Week im 48er-Tandler zeigt, wie Kreislaufwirtschaft Alltag und Geldbörsen entlastet. Zwischen Black-Friday-Rabatten und Kaufrausch bietet die Stadt eine greifbare, lokale Alternative: weiterverwenden statt neukaufen, reparieren statt wegwerfen. Wien knüpft damit an eine gelebte Praxis an, die in den Grätzeln längst Heimat gefunden hat – vom Nähcafé bis zum Reparaturtisch. Wer wissen will, wie Abfallvermeidung und Lebensfreude zusammengehen, findet ab 25. November 2025 in Margareten und der Donaustadt Antworten, Anleitungen und Inspiration. Die Botschaft ist klar, die Wirkung unmittelbar: Was wir in den kommenden Tagen in Wien ausprobieren, kann dauerhaft in unseren Alltag einziehen – und zwar ohne Verzichtsrhetorik, dafür mit praktischen Tipps, fairen Preisen und einem Mehrwert für Umwelt und Gemeinwohl.
Orange Week in Wien: Kreislaufwirtschaft im Alltag erleben
Die Stadt Wien, konkret die 48er, laden bereits zum dritten Mal zur Orange Week im 48er-Tandler ein. Das Format versteht sich als nachhaltige Alternative zur Konsumspitze rund um den Black Friday. Geboten wird ein vielfältiges Programm von Dienstag, 25. bis Samstag, 29. November 2025 – mit Müllkasperl für Kinder, Nähcafés, täglichen Themenschwerpunkten zu Textilien und Elektrogeräten, Reparatur- und Wartungstipps, Second-Hand-Modeberatung, kreativen Kurzworkshops mit alltagstauglichen Life-Hacks, Kleidertausch-Aktionen sowie den beliebten Reparaturcafés. Details, Adressen und Hinweise auf Sonderpunkte sind im offiziellen Programm abrufbar: 48er-Tandler Orange Week 2025. Grundlage dieser Berichterstattung ist die Aussendung der Stadt Wien – Kommunikation und Medien (KOM), abrufbar über die OTS-Quelle.
Die heurige Eröffnung steht am Dienstag ab 16:00 Uhr unter dem Zeichen des Life-Hack-Day. Neu mit dabei: die Wiener Volkshochschulen, die in Schauwerkstätten – etwa zur Möbelreparatur – Einblicke in Kurse zum Motto »weiterverwenden statt neukaufen bzw. reparieren« geben. Der 48er-Tandler bleibt dabei, was er ist: ein Second-Hand-Markt mit sozialem Mehrwert, dessen Erlöse karitativen Einrichtungen zugutekommen. Pressebilder stellt die Stadt über presse.wien.gv.at/bilder bereit.
Die wichtigsten Fachbegriffe verständlich erklärt
Kreislaufwirtschaft
Kreislaufwirtschaft beschreibt ein Wirtschaftsmodell, das Produkte und Materialien möglichst lange im Umlauf hält. Statt linearem »Nehmen–Herstellen–Wegwerfen« setzt Kreislaufwirtschaft auf Wiederverwendung, Reparatur, Aufbereitung und Recycling. Ziel ist, Abfall zu vermeiden, Ressourcen zu schonen und CO₂-Emissionen zu senken. Praktisch bedeutet das: Dinge werden so gestaltet, genutzt und gepflegt, dass sie mehrfach einsetzbar bleiben; ausgediente Teile werden als Rohstoffe für Neues genutzt. Für Haushalte ist der Einstieg niederschwellig: reparieren, tauschen, gebraucht kaufen – und dadurch die Lebensdauer von Alltagsgütern verlängern.
Abfallvermeidung
Abfallvermeidung ist der Vorrang im Umweltschutz: Der beste Müll ist jener, der gar nicht entsteht. Das beginnt bei der Kaufentscheidung – bewusst wählen, was wirklich gebraucht wird – und reicht bis zur Pflege und Reparatur. Abfallvermeidung schont nicht nur Deponien und Verbrennungsanlagen, sondern spart Energie und Geld. In der Praxis zeigt sich das in Mehrweg- statt Einwegverpackungen, in der gemeinsamen Nutzung (Sharing), in Leih- statt Kaufentscheidungen und in der Weitergabe noch brauchbarer Gegenstände. Im städtischen Kontext helfen ReUse-Shops wie der 48er-Tandler, diese Prinzipien alltagstauglich zu machen.
Wiederverwendung
Wiederverwendung bedeutet, ein Produkt in seiner ursprünglichen Form erneut zu nutzen – ohne es in seine Bestandteile zu zerlegen. Ein gut erhaltenes Möbelstück findet einen neuen Haushalt, ein funktionierendes Elektrogerät bekommt ein zweites Leben, ein Kleidungsstück sorgt weiter für Freude. Wiederverwendung steht im Abfallhierarchiemodell ganz oben, weil sie Ressourcen spart und Abfall gar nicht erst entstehen lässt. Besonders sinnvoll ist sie bei langlebigen Gütern wie Möbeln, Werkzeugen oder Textilien, die mit wenig Aufwand weiterverwendet werden können.
Recycling
Recycling setzt später an: Materialien aus ausgedienten Produkten werden aufbereitet und als Rohstoffe wieder in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Glas, Papier, Metalle und bestimmte Kunststoffe lassen sich gut recyceln. Recycling ist wichtig, wenn Wiederverwendung oder Reparatur nicht mehr möglich sind. Es benötigt jedoch Energie und ist von Qualität und Sortenreinheit der gesammelten Materialien abhängig. Im Zusammenspiel mit Wiederverwendung bildet Recycling einen zentralen Baustein der Kreislaufwirtschaft.
Reparaturcafé
Ein Reparaturcafé ist eine offene Werkstatt auf Zeit, in der Menschen defekte Gegenstände gemeinsam mit ehrenamtlichen oder professionellen Reparateurinnen und Reparaturern wieder in Schuss bringen. Der Fokus liegt auf Hilfe zur Selbsthilfe: Man lernt, wie ein Gerät geöffnet wird, welche Teile verschleißen und wie man sie tauscht. Neben dem praktischen Nutzen stärkt das Gemeinschaftsgefühl und vermittelt Fähigkeiten, die im Alltag Geld sparen. Reparaturcafés sind zugleich Lernorte und Treffpunkte, an denen Ressourcen geschont und Dinge vor der Entsorgung bewahrt werden.
Second-Hand-Markt
Ein Second-Hand-Markt ist ein Verkaufspunkt für bereits genutzte, aber weiterhin brauchbare Gegenstände. Die Bandbreite reicht von Kleidung und Büchern bis zu Möbeln, Geschirr und Elektrogeräten. Second-Hand schont Ressourcen, weil für den nächsten Nutzungszyklus keine Neuproduktion nötig ist. In Wien steht der 48er-Tandler als städtisches Konzept für geprüfte Ware, faire Preise und einen sozialen Zweck, da Erlöse karitativen Projekten zufließen. Kundinnen und Kunden profitieren von Auswahl, Authentizität und Originalität jenseits kurzlebiger Trends.
European Week of Waste Reduction
Die European Week of Waste Reduction (EWWR) ist eine europaweite Aktionswoche, die Bewusstsein für Abfallvermeidung, Wiederverwendung und Recycling schafft. Kommunen, Schulen, Unternehmen und Zivilgesellschaft setzen dabei konkrete Initiativen, um zu zeigen, wie Ressourcen geschont werden können. Aktionen reichen von Sammel- und Reparaturinitiativen bis zu Bildungsformaten. Die Orange Week 2025 in Wien reiht sich in diesen europäischen Rahmen ein und verbindet lokale Praxis mit europäischer Zielsetzung – ein sinnvoller Schulterschluss zwischen Stadtgesellschaft und EU-Impulsen.
Life-Hacks
Life-Hacks sind einfache, praktikable Tipps, die den Alltag erleichtern und oft überraschende Lösungen für kleine Probleme bieten. Im Kontext der Orange Week geht es um Hacks, die Ressourcen sparen: etwa wie man Kleidung länger frisch hält, kleine Möbelmacken repariert, Haushaltsgeräte richtig wartet oder mit einfachen Mitteln Reparaturen vorbereitet. Life-Hacks senken Hemmschwellen, weil sie niederschwellig Wissen vermitteln, das sofort ausprobiert werden kann – vom Flicken bis zum Pflegen.
Historische Entwicklung: Von der Wegwerfgesellschaft zur Reparaturkultur
Über Jahrzehnte dominierte in vielen Industrieländern ein lineares Wirtschaftsmodell: produzieren, konsumieren, entsorgen. Mit steigendem Wohlstand wuchs die Menge an kurzlebigen Gütern. Gleichzeitig wurden Lieferketten globaler, Produkte komplexer und Reparaturen seltener. Ab den 1990er-Jahren rückten Abfallvermeidung und getrennte Sammlung schrittweise in das öffentliche Bewusstsein. Städte setzten auf Sammelsysteme, Umweltbildung und erste ReUse-Initiativen. In Österreich gewann das Thema zusätzlich durch kommunale Abfallwirtschaft und zivilgesellschaftliche Projekte an Dynamik: Flohmärkte etablierten sich neu, Reparaturinitiativen entstanden, und der Gedanke, Gutes weiterzugeben, bekam einen festen Platz im Stadtleben.
Die kommunalen ReUse-Shops waren dabei ein Meilenstein: Sie verbanden ökologische Ziele (weniger Abfall, Schonung von Ressourcen) mit sozialem Nutzen (leistbare Güter, Unterstützung karitativer Einrichtungen). In Wien schufen Formate wie der 48er-Tandler eine institutionelle Anlaufstelle für Menschen, die Dinge statt zu entsorgen weitergeben oder gebraucht erwerben wollen. Damit wurde aus einer spontanen Praxis, die vorher vielfach in privaten Kreisen oder auf informellen Märkten stattfand, ein verlässliches Angebot mit klaren Qualitätsstandards, Beratung und Service.
Parallel wuchs europaweit die Erkenntnis, dass nachhaltiger Konsum kein Nischenthema bleibt. EU-Strategien zur Kreislaufwirtschaft, nationale Aktionspläne und lokale Bildungsarbeit verschränkten sich. Heute gilt: Reparieren, Tauschen, Wiederverwenden und recyceln sind keine Gegensätze zum urbanen Lebensstil; sie sind dessen zukunftsfähige Weiterentwicklung. Die Orange Week baut genau darauf auf – sie ist Schaufenster, Lernort und Fest der Möglichkeiten, das im Alltag wirkt.
Programm, Orte und Zeiten: So ist die Woche aufgebaut
Die Orange Week läuft von Dienstag, 25. bis Samstag, 29. November 2025. Die Eröffnung am Dienstag findet ab 16:00 Uhr im 48er-Tandler Margareten statt (5., Siebenbrunnenfeldgasse 3) und widmet sich dem Life-Hack-Day. Von Mittwoch bis Samstag sind Programmpunkte laut Aussendung von 10:00 bis 18:00 Uhr vorgesehen. Der zweite Standort in der Donaustadt (22., Percostraße 2) ist Teil der Orange Week; die konkrete Verteilung der Aktivitäten entnehmen Interessierte dem offiziellen Programm unter 48ertandler.wien.gv.at/orange-week-2025.
- Dienstag, 25.11.2025: 16–19 Uhr, Eröffnungstag mit Life-Hacks, Fokus auf praktische Tipps; laut Aussendung nur im 48er-Tandler Margareten.
- Mittwoch bis Samstag, 26.–29.11.2025: 10–18 Uhr, Themenschwerpunkte Textilien und Elektrogeräte, Nähcafés, Reparatur- und Wartungstipps, Second-Hand-Modeberatung, Kurzworkshops, Kleidertausch und Reparaturcafés.
- Fortlaufend: Second-Hand-Sortiment zum Stöbern, Einkaufen und Spenden – Erlöse kommen karitativen Einrichtungen zugute.
Zahlen und Fakten: Was sich aus der Aussendung ablesen lässt
Aus den genannten Zeiten ergibt sich ein kompaktes, aber dichtes Wochenprogramm:
- Fünf Veranstaltungstage (Dienstag bis Samstag).
- Öffnungszeiten laut Aussendung: Dienstag 3 Stunden (16–19 Uhr), Mittwoch bis Samstag jeweils 8 Stunden; das ergibt mindesten 35 Programmstunden in der Woche.
- Zwei Standorte: Margareten (5., Siebenbrunnenfeldgasse 3) und Donaustadt (22., Percostraße 2).
- Acht zentrale Programmschienen: Müllkasperl, Nähcafé, Textil-Schwerpunkt, Elektro-Schwerpunkt, Reparatur- und Wartungstipps, Modeberatung, Kurzworkshops mit Life-Hacks, Kleidertausch sowie Reparaturcafés.
- Charity-Aspekt: Der Erlös des Second-Hand-Verkaufs kommt karitativen Einrichtungen zugute – ein doppelter Mehrwert für Stadtgesellschaft und Umwelt.
Diese Eckpunkte zeigen: Die Orange Week ist bewusst niederschwellig und alltagsnah gestaltet. Wer nur eine Stunde Zeit hat, kann eine Station besuchen; wer tiefer eintauchen will, findet vier volle Tage mit jeweils acht Stunden Programmfenster. Der Dienstag setzt mit dem Life-Hack-Day einen thematischen Auftakt und senkt Hürden, etwa für Erstbesucherinnen und Erstbesucher.
Vergleiche: Wien im Kontext der Bundesländer und der DACH-Region
Österreichweit ist das Thema Wiederverwendung in Städten und Gemeinden angekommen. In den Bundesländern finden sich unterschiedliche Formate: städtische ReUse-Shops, regionale Reparaturboni, Repair-Gemeinschaften in Bibliotheken der Dinge, Tauschbörsen in Gemeindezentren. Wien sticht durch die Kombination aus kommunaler Infrastruktur, kontinuierlicher Bildungsarbeit und einer starken Sichtbarkeit im öffentlichen Raum hervor. Die Orange Week bündelt diese Elemente und verknüpft sie mit einem klaren Zeitpunkt, an dem der Konsumdruck traditionell hoch ist.
In Deutschland haben zahlreiche Kommunen vergleichbare Angebote – von Wertstoffhöfen mit ReUse-Abteilungen bis zu regelmäßigen Reparaturcafés, die von Zivilgesellschaft und Kommunen gemeinsam getragen werden. Städte wie Berlin oder München setzen ebenfalls auf Aufbereitung und Wiederverkauf. In der Schweiz gibt es eine lange Tradition qualitätsorientierter Wiederverwendung, getragen von Sozialunternehmen, Brockenstuben und kommunalen Betrieben. Gemeinsam ist der DACH-Region die wachsende Überzeugung, dass Langlebigkeit und Reparierbarkeit kein Rückschritt sind, sondern Innovationsfelder, in denen Handwerk, Bildung und Gemeinwesen zusammenwirken. Wien positioniert sich in diesem Feld sichtbar, indem es ReUse nicht nur als Service, sondern als Stadtidee inszeniert – mit einer Woche, die zum Mitmachen einlädt.
Was bedeutet das für Bürgerinnen und Bürger konkret?
Die Auswirkungen sind unmittelbar im Alltag spürbar:
- Kosten senken: Wer ein gebrauchtes Möbelstück erwirbt oder Kleidung tauscht, spart gegenüber dem Neukauf oft deutlich. Reparaturtipps helfen, Geräte länger zu nutzen und Neuanschaffungen hinauszuschieben.
- Wissen aufbauen: In Nähcafés und Reparaturcafés lernt man Fertigkeiten, die über die Woche hinaus wirken – vom Flicken bis zur Wartung von Haushaltsgeräten. Dieses Wissen stärkt die Selbstständigkeit und reduziert Hemmschwellen vor künftigen Reparaturen.
- Umwelt entlasten: Jeder vermiedene Neukauf spart Ressourcen und CO₂, jeder reparierte Gegenstand bleibt länger im Kreislauf. Das lässt sich im Kleinen sofort umsetzen – etwa durch Pflege, einfache Ersatzteile oder richtige Lagerung.
- Gemeinschaft erleben: Reparieren und Tauschen sind soziale Aktivitäten. Man tauscht Erfahrungen, lernt von anderen und wird Teil einer Gemeinschaft, die Verantwortung übernimmt – im eigenen Grätzel und darüber hinaus.
Ein Beispiel: Eine Familie bringt ein wackeliges Regal zum Reparaturpunkt. Mit einer kurzen Anleitung und wenigen Handgriffen – Holzleim, Schrauben, Winkel – wird es stabilisiert. Das spart einen Neukauf, verhindert Abfall und vermittelt Know-how, das später auch an einem zweiten Möbelstück angewandt werden kann. Ein anderes Beispiel: Eine Winterjacke bekommt in einem Nähcafé einen neuen Reißverschluss. Statt sie zu ersetzen, bleibt sie weitere Saisonen nutzbar. Das gleiche Prinzip lässt sich bei Elektrogeräten anwenden: Wer lernt, Filter zu reinigen, Dichtungen zu tauschen oder Akkus richtig zu pflegen, verlängert die Lebensdauer deutlich.
Kontext: Warum ausgerechnet rund um Black Friday?
Der Zeitraum um den Black Friday bündelt Rabattaktionen und erhöht die Kaufbereitschaft. Gerade hier setzt die Orange Week ein Signal: Konsumdruck ist nicht naturgegeben, sondern gestaltbar. Die Stadt zeigt Alternativen, die Freude am Entdecken mit Verantwortung verbinden. Statt Schnäppchenjagd tritt der Gedanke, Dinge länger zu nutzen, zu teilen und weiterzugeben. Das ist keine moralische Belehrung, sondern eine Einladung: Wer ausprobieren will, findet Orte, Menschen und Methoden, die funktionieren und Spaß machen. Wien verbindet so Umweltschutz mit urbaner Lebensqualität – ein Anliegen, das auch Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky in der Aussendung betont: »Die Orange Week ist das beste Beispiel dafür, wie Kreislaufwirtschaft funktionieren kann.«
Rechtliche und ethische Aspekte: Was seriöse Berichterstattung ausmacht
Die vorliegenden Informationen stammen aus der offiziellen Aussendung der Stadt Wien – Kommunikation und Medien (KOM). Dieser Beitrag folgt den Richtlinien des österreichischen Presserats: sachlich, nachvollziehbar, ohne Übertreibung und ohne unbelegte Behauptungen. Zitate werden kenntlich gemacht, Programmangaben werden auf die Quelle zurückgeführt. Für Detailfragen, kurzfristige Änderungen oder tagesaktuelle Ergänzungen ist das offizielle Programm maßgeblich: Programm der Orange Week. Pressefotos hält die Stadt unter presse.wien.gv.at/bilder bereit.
Ausblick: Wie es nach der Orange Week weitergehen kann
Die Orange Week wirkt über die fünf Tage hinaus: Wer einmal eine Reparatur selbst geschafft hat, wird beim nächsten Defekt seltener wegwerfen. Wer gute Erfahrungen mit Second-Hand gemacht hat, integriert ReUse in den eigenen Routinekauf. Und wer im Nähcafé eine Technik gelernt hat, gibt das Wissen oft im Freundes- oder Familienkreis weiter. So entsteht ein Multiplikatoreffekt. Kommunal betrachtet bieten sich Anschlussprojekte an: regelmäßige Reparaturtreffs in den Grätzeln, saisonale Textil-Schwerpunkte, Kooperationen mit Schulen, Lehrwerkstätten und den Wiener Volkshochschulen. Auch die Verzahnung mit sozialen Initiativen lässt sich vertiefen, etwa durch gezielte Spenden- und Weitergabe-Programme.
Europaweit ist zu erwarten, dass die Relevanz der Kreislaufwirtschaft weiter steigt. Kommunale Initiativen, die praktische Fähigkeiten vermitteln, bleiben dabei ein Schlüssel: Sie machen aus der abstrakten Idee konkrete Handlungen. Wien positioniert sich hier als Vorreiterin auf Stadtebene, indem es niederschwellige Angebote schafft, die Lernfreude und Ressourcenschutz verbinden. Das stärkt nicht nur die ökologische Seite, sondern auch lokale Gewerbe – von Reparaturbetrieben bis zu Sozialunternehmen – und es entlastet Haushaltsbudgets in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten.
Tipps für den Besuch: So holen Sie das Beste aus der Woche
- Programm vorab prüfen: Welche Schwerpunkte passen zu Ihrem Bedarf? Der Link führt direkt zu den Terminen und Orten.
- Gegenstände mitnehmen: Defekte, aber tragbare Stücke – von der Lampe bis zur Lieblingsjacke – eignen sich für Reparatur- oder Nähstationen.
- Zeitfenster einplanen: Dienstags ein kurzer, kompakter Start; Mittwoch bis Samstag jeweils acht Stunden Programmbühne.
- Kleidung für den Tausch vorbereiten: Sauber, intakt, sortiert – so macht der Kleidertausch allen Freude.
- Fragen notieren: Von Pflege über Wartung bis zur Wiederverwendung – je konkreter die Frage, desto hilfreicher die Antwort vor Ort.
Quellen und weiterführende Informationen
Offizielle Aussendung: Stadt Wien – Kommunikation und Medien (KOM), über OTS abrufbar: Kreislauf statt Kaufwahn: Der 48er-Tandler lädt zur Orange Week. Programmübersicht der Stadt: Orange Week 2025. Pressebilder: presse.wien.gv.at/bilder. Die Orange Week ist Teil der European Week of Waste Reduction.
Schluss: Was bleibt – und was jede und jeder tun kann
Die Orange Week 2025 zeigt, wie Wien Kreislaufwirtschaft greifbar macht: mit konkreten Tipps, praktischen Stationen und einem Second-Hand-Angebot, das Umwelt- und Sozialnutzen verbindet. Fünf Tage reichen, um Berührungsängste abzubauen und neue Gewohnheiten zu starten. Wer einmal erlebt hat, wie einfach ein Knopf angenäht, ein Regal stabilisiert oder ein Gerät gewartet werden kann, erkennt: Nachhaltigkeit beginnt im Kleinen – und bewirkt im Großen viel.
Unser Vorschlag: Nutzen Sie die Woche für einen ersten Schritt. Bringen Sie ein Teil zum Reparieren mit, probieren Sie einen Kleidertausch aus oder holen Sie sich eine Wartungsanleitung. So entsteht eine Routine, die Geldbeutel und Umwelt entlastet. Alle Details finden Sie im offiziellen Programm. Welche Life-Hacks werden Sie nach der Orange Week dauerhaft beibehalten?