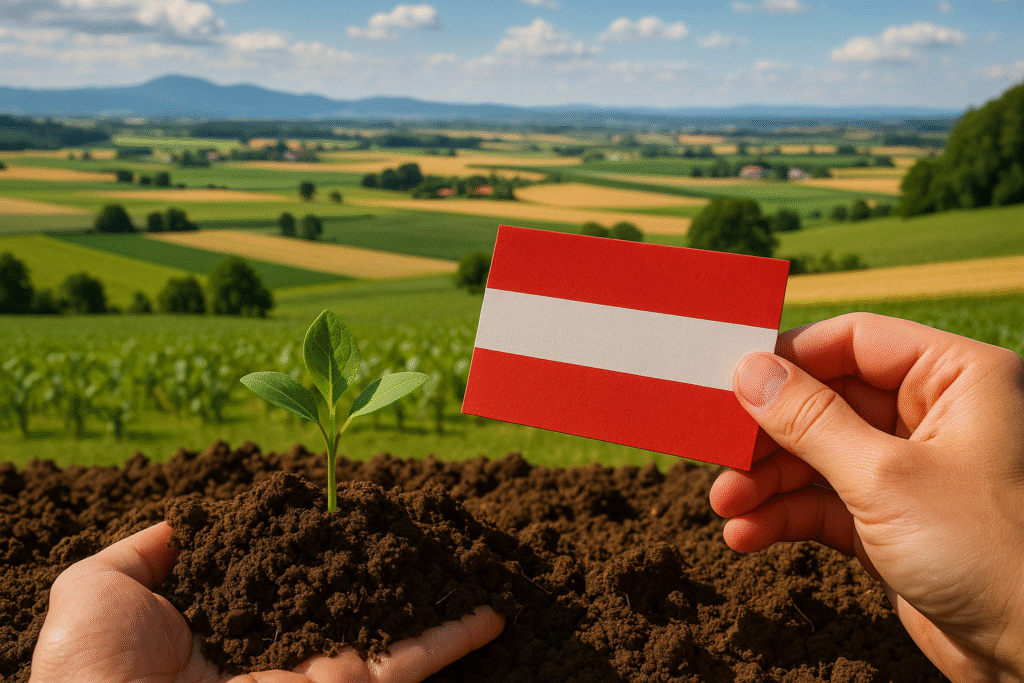Die Stimmung ist eindeutig, die Konsequenzen noch offen: Eine neue, repräsentative Umfrage im Auftrag des WWF sorgt am 2025-11-28 für Gesprächsstoff in allen Bundesländern. Viele Menschen spüren, dass unser Umgang mit Boden und Fläche nicht mehr in die Zeit passt – und dass die Politik gefordert ist, klare Leitplanken zu setzen. Zugleich ist die Sache komplex: Was genau bedeutet eine Obergrenze für den Bodenverbrauch? Welche Folgen hat Bodenversiegelung im Alltag von Gemeinden, Betrieben, Pendlerinnen und Pendlern, Landwirtinnen und Landwirten? Und wie lässt sich nachhaltige Entwicklung mit leistbarem Wohnen und guter Erreichbarkeit vereinbaren? Die Daten der market-Studie zeichnen ein deutliches Bild, doch hinter den Prozentwerten stehen handfeste Entscheidungen über Raumordnung, Steuern und Infrastruktur. Dieser Überblick ordnet die Ergebnisse ein, erklärt zentrale Begriffe leicht verständlich, vergleicht Herangehensweisen in Österreich, Deutschland und der Schweiz und zeigt, was das für Bürgerinnen und Bürger konkret bedeutet – heute und in den nächsten Jahren.
Bodenschutz in Österreich: Umfrage, Kontext, Folgen
Laut der neuen market-Umfrage für den WWF wünschen sich 76 Prozent der österreichischen Bevölkerung strengere Gesetze und Maßnahmen gegen die Verbauung der Landschaft und den Bodenverbrauch. Rund drei Viertel (kumuliert 74 Prozent »auf jeden Fall« und »eher schon«) befürworten eine verbindliche Obergrenze beim Bodenverbrauch. Nur 20 Prozent halten die bisherigen politischen Anstrengungen für ausreichend, 66 Prozent sehen das gegenteilig, 14 Prozent wollten oder konnten sich nicht festlegen. Besonders präsent sind Sorgen um den Verlust wertvoller Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten. Über 40 Prozent nennen die Verstärkung von Überschwemmungen als Sorge, 34 Prozent den Verlust fruchtbarer Äcker und 31 Prozent stärkere Hitzewellen im Sommer. In der eigenen Wohnumgebung nahmen 63 Prozent »zu viel« oder »eher zu viel« Verbauung wahr, während lediglich fünf Prozent meinen, es könnte noch mehr verbaut werden. Diese Einschätzungen ziehen sich quer durch Altersgruppen und Bundesländer.
WWF-Bodenschutz-Sprecher Simon Pories betont, die Bundesregierung solle dem Thema mehr Priorität einräumen und mit den Ländern einen Bodenschutz-Vertrag verhandeln. market-Studienleiterin Birgit Starmayr verweist auf stabile Mehrheiten über Parteigrenzen hinweg. Damit ist das Thema klar auf der politischen Agenda. Im Folgenden ordnen wir die Zahlen ein, erklären die wichtigsten Fachbegriffe und zeigen, welche Instrumente Gemeinden und Länder zur Verfügung haben – und was eine Obergrenze praktisch bedeuten könnte.
Zahlen & Fakten der market-Umfrage: Was die Prozente bedeuten
Die Befragung wurde von market im Auftrag des WWF durchgeführt. Stichprobe: 1.000 Personen, online rekrutiert, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ab 16 Jahren. Der Befragungszeitraum lag zwischen 10. und 15. November 2025. Die ausgewiesene Schwankungsbreite beträgt ±3,16 Prozentpunkte.
In absoluten Größen entspricht der 76-Prozent-Wert für strengere Gesetze rechnerisch etwa 760 von 1.000 Befragten. Der 74-Prozent-Wert für eine Obergrenze beim Bodenverbrauch entspricht rund 740 Personen. 20 Prozent, also etwa 200 Personen, halten die bisherigen Maßnahmen für ausreichend; 66 Prozent (circa 660) sehen das anders; 14 Prozent (rund 140) haben keine Angabe gemacht oder sind unentschieden. 63 Prozent (ungefähr 630 Personen) nehmen in ihrer Umgebung zu viel Verbauung wahr; fünf Prozent (etwa 50 Personen) sehen noch Spielraum nach oben.
Mit der genannten Schwankungsbreite lassen sich grobe Vertrauensintervalle ableiten: Für den 76-Prozent-Wert läge ein plausibler Bereich bei etwa 73 bis 79 Prozent, für die 74-Prozent-Zustimmung zu einer Obergrenze bei etwa 71 bis 77 Prozent. Bei der Bewertung politischer Anstrengungen (20 Prozent »ausreichend«) reicht der Bereich grob von 17 bis 23 Prozent. Solche Bereiche zeigen: Die Mehrheit ist stabil, kleine Abweichungen in der Punktzahl ändern am Grundmuster nichts.
Inhaltlich sind die Top-Sorgen der Bevölkerung vielschichtig: Verlust von Lebensräumen, mehr Überschwemmungen, Verlust fruchtbarer Äcker, intensivere Hitzewellen. Diese Reihenfolge passt zum Erfahrungswissen zahlreicher Gemeinden, die in Hitzeperioden mit überhitzten Ortszentren kämpfen und bei Starkregenereignissen lokale Überflutungen erleben. Für Landwirtinnen und Landwirte steht der Erhalt produktiver Böden im Vordergrund, für Anrainerinnen und Anrainer die Lebensqualität, für Kommunen die Kosten der technischen Infrastruktur.
Quelle und weitere Details: WWF Österreich über OTS; vollständige Presseunterlage mit Kennzahlen und Grafiken ist hier abrufbar: OTS-Presseaussendung.
Begriffe einfach erklärt: Von Bodenverbrauch bis Schwankungsbreite
Bodenverbrauch: Unter Bodenverbrauch versteht man die Inanspruchnahme bisher unbebauter oder landwirtschaftlich genutzter Flächen für Siedlungen, Gewerbe, Verkehr oder Infrastruktur. Er umfasst sowohl die tatsächliche bauliche Nutzung als auch die Vorhalteflächen, die widmungsrechtlich bereits für künftige Nutzung reserviert sind. Bodenverbrauch schmälert dauerhaft die Verfügbarkeit von Flächen für Landwirtschaft, Natur und Erholung. Er ist nicht beliebig rückgängig zu machen, da Infrastruktur Folgekosten und Planungslogiken nach sich zieht, die eine Rückumwandlung erschweren.
Bodenversiegelung: Bodenversiegelung bezeichnet die Überdeckung des Bodens durch dichte Materialien wie Asphalt, Beton oder Pflaster, wodurch die natürlichen Funktionen des Bodens – Wasseraufnahme, Kühlung durch Verdunstung, Lebensraum für Bodenorganismen – stark eingeschränkt oder aufgehoben werden. Versiegelte Flächen erhöhen Oberflächenabfluss, verschärfen Überflutungsrisiken bei Starkregen und verstärken Hitzeinseln in Städten. Selbst teilweise durchlässige Beläge können die natürlichen Funktionen nicht vollständig ersetzen. Entsiegelung ist technisch möglich, aber aufwendig und teuer.
Raumordnung: Raumordnung ist der übergeordnete Planungsrahmen, mit dem Bund, Länder und Gemeinden die Nutzung von Flächen steuern. In Österreich liegt die Raumordnung primär bei den Ländern. Sie legen Ziele fest, erstellen Programme und Genehmigungsregeln, die Gemeinden in ihren Flächenwidmungsplänen konkretisieren. Ziel der Raumordnung ist ein geordnetes, nachhaltiges Nebeneinander von Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Landwirtschaft, Erholung und Naturschutz. Sie wirkt langfristig, weil Widmungen Erwartungen wecken und Investitionen lenken.
Flächenwidmung: Die Flächenwidmung ist das kommunale Instrument, das festlegt, welche Nutzung auf einer bestimmten Fläche zulässig ist – etwa Bauland, Grünland, Verkehrsflächen oder Sondernutzungen. Widmungen schaffen Planungssicherheit, beeinflussen Grundstückswerte und sind die operative Ebene, auf der über Innenentwicklung (Nutzung bestehender Siedlungsflächen) oder Außenentwicklung (neue Baugebiete) entschieden wird. Eine vorausschauende Flächenwidmung stärkt Ortskerne und spart Infrastrukturkosten, während zersiedelte Außenentwicklung weite Wege erzeugt.
Obergrenze beim Bodenverbrauch: Eine Obergrenze legt fest, wie viel zusätzliche Fläche pro Zeitraum (etwa pro Jahr) maximal neu verbraucht oder versiegelt werden darf. Sie kann national, auf Landes- oder Gemeindeebene ausgestaltet sein und wird oft von Ausgleichsmechanismen begleitet, etwa Entsiegelungsverpflichtungen oder Kontingenten. Die Idee dahinter: Der Boden ist eine endliche Ressource. Mit einer Obergrenze wird Flächensparen zur verbindlichen Leitlinie, die Anreize für Innenentwicklung, Nachverdichtung und Revitalisierung von Brachflächen setzt.
Bodenschutz-Vertrag: Ein Bodenschutz-Vertrag zwischen Bund und Ländern wäre ein politisch-rechtlicher Rahmen, der Ziele, Kennzahlen, Zuständigkeiten und Umsetzungsinstrumente bündelt. Vergleichbar mit Vereinbarungen in anderen Politikfeldern regelt er, wie Obergrenzen definiert, wie Fortschritte gemessen und wie Maßnahmen finanziert werden. Ein solcher Vertrag könnte zudem Mindeststandards, Monitoring, Berichtspflichten und Sanktionen bei Verfehlungen enthalten, um das Flächensparen über Landesgrenzen hinweg konsistent zu verankern.
Ökologisierung des Steuersystems: Damit ist die Ausrichtung von Abgaben und Anreizen gemeint, um umweltschonendes Verhalten zu fördern und schädliche Wirkungen zu verteuern. Im Kontext Bodenschutz betrifft das etwa die Gestaltung von Grund- und Bodenabgaben, Abschreibungen, Pendler- und Flächenförderungen. Ziel ist, Sanierung, Nachverdichtung und die Nutzung bestehender Infrastruktur attraktiver zu machen als Neuerschließungen auf der grünen Wiese. Ökologische Lenkungswirkungen sollen Investitionsentscheidungen in eine nachhaltige Richtung verschieben.
Umweltschädliche Subventionen: Darunter versteht man direkte oder indirekte finanzielle Begünstigungen, die Aktivitäten mit negativen Umweltwirkungen fördern oder nicht ausreichend eindämmen. Beim Bodenschutz können das Zuschüsse oder Steuerregeln sein, die Zersiedelung begünstigen, etwa indem sie lange Wege, große Parkflächen oder Neuerschließungen relativ günstiger machen als die Revitalisierung bestehender Standorte. Der Abbau solcher Subventionen soll Wettbewerbsbedingungen zugunsten flächensparender Lösungen verbessern.
Schwankungsbreite (Fehlerspanne): Die Schwankungsbreite ist die statistische Unsicherheit einer Stichproben-Schätzung. Bei 1.000 Befragten und einer Fehlerspanne von ±3,16 Prozentpunkten bedeutet das: Ein gemessener Wert von 50 Prozent kann in der Grundgesamtheit plausibel zwischen etwa 47 und 53 Prozent liegen. Je größer die Stichprobe, desto geringer die Schwankungsbreite. Sie ist wichtig, um Ergebnisse nicht überzutreten und zu verstehen, dass kleine Unterschiede oft nicht signifikant sind.
Historische Entwicklung: Wie Österreich mit Fläche umging
Die Debatte um Bodenverbrauch und Bodenversiegelung ist in Österreich nicht neu, hat aber in den vergangenen zwei Jahrzehnten stark an Dynamik gewonnen. Nach dem massiven Siedlungs- und Verkehrsflächenwachstum der Nachkriegszeit folgte eine Phase, in der die räumliche Expansion zwar moderater wurde, jedoch weiterhin auf Außenentwicklung setzte. Viele Gemeinden legten neue Baugebiete an den Rändern fest, um Nachfrage nach Einfamilienhäusern, Gewerbegrundstücken und Parkflächen zu bedienen. Parallel dazu veränderten sich Mobilität und Handel: Große Fachmarktzentren und Gewerbeparks entstanden oft auf der grünen Wiese, nahe hochrangigen Straßen. Diese Struktur prägte Wegeketten, schwächte in manchen Regionen gewachsene Ortskerne und erhöhte den Flächenbedarf pro Kopf.
Mit dem Klimawandel, häufigeren Hitzewellen und Starkregenereignissen rückten die ökologischen und ökonomischen Kosten stärker in den Fokus. Versiegelte Flächen tragen zur Aufheizung von Siedlungsräumen bei; fehlende Versickerungsflächen verschärfen lokale Überflutungen. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein, dass landwirtschaftlich produktive Böden und naturnahe Lebensräume nicht beliebig vermehrbar sind. Auf EU-Ebene werden Strategien zur Bodengesundheit diskutiert; in Österreich bekennen sich Bundes- und Landespolitik seit Jahren zu Flächensparen und Innenentwicklung – die Umsetzung bleibt jedoch anspruchsvoll, weil Finanzierungslogiken, Widmungsrechte und lokale Entwicklungserwartungen ineinandergreifen. Der nun sichtbare Meinungsumschwung in der Bevölkerung – mit klaren Mehrheiten für strengere Regeln und eine Obergrenze – baut genau auf dieser jahrelangen Erfahrung auf: Der Boden ist endlich, und Planungsentscheidungen wirken über Generationen.
Vergleich: Österreichs Länder, Deutschland und die Schweiz
Österreich ist föderal organisiert. Die Raumordnung liegt in der Kompetenz der Länder, die wiederum den Gemeinden detaillierte Planungsaufgaben übertragen. Daraus entsteht Vielfalt: Manche Länder setzen stärker auf Innenentwicklung, Nachverdichtung und Ortskernstärkung, andere erlauben großzügigere Außenentwicklung. Instrumente wie Brachflächenkataster, Bebauungsdichtevorgaben, Mindestbebauungen und Mobilitätskonzepte werden unterschiedlich genutzt. In verdichteten Regionen, etwa rund um die Landeshauptstädte, spielt der öffentliche Verkehr eine zentrale Rolle, um flächensparend zu wachsen. Ländliche Regionen suchen dagegen oft den Ausgleich zwischen Standortattraktivität und Flächenschutz, etwa durch Clustering von Gewerbe statt Zersplitterung in viele kleine Standorte.
Deutschland kennt ebenfalls eine starke kommunale Planungshoheit, jedoch mit bundesgesetzlichen Leitplanken, insbesondere im Baugesetzbuch. Seit Jahren verfolgt die deutsche Politik das Ziel, den täglichen Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche deutlich zu reduzieren und langfristig gegen null zu bringen. Debatten um Flächenziele, Innenentwicklung vor Außenentwicklung und Entsiegelung sind dort ähnlich präsent wie in Österreich. In der Praxis helfen städtebauliche Verträge, Baulandmodelle oder kommunale Bodenpolitik, Flächen effizienter zu nutzen und Preisdynamiken zu dämpfen.
Die Schweiz verfügt mit dem Raumplanungsgesetz über ein starkes Instrumentarium, das Wachstum der Siedlungsfläche an den tatsächlichen Bedarf koppelt und die Innenentwicklung ins Zentrum stellt. Überdimensionierte Bauzonen müssen reduziert, unbebaute Reserven in den Siedlungsgebieten aufgeschlossen und verdichtet werden, bevor neue Bauzonen ausgewiesen werden. Finanzielle Mechanismen wie die Mehrwertabgabe schaffen Anreize, Bodengewinne zum Teil abzuschöpfen und in Infrastruktur und Qualität zu reinvestieren. Für Österreich bietet dieser Ansatz Anknüpfungspunkte: eine konsequente Priorität für Innenentwicklung, klare Vorgaben für Bauzonen und ein abgestimmtes Zusammenspiel von Planung und Finanzierung.
Was bedeutet das für Bürgerinnen und Bürger?
Die Ergebnisse der Umfrage sind nicht nur abstrakt. Sie betreffen das tägliche Leben in Gemeinden und Städten:
- Lebensqualität im Sommer: Mehr Bäume, Grünflächen und entsiegelte Innenhöfe kühlen Siedlungen. Das reduziert Hitzestress für ältere Menschen, Kinder und alle, die im Freien arbeiten.
- Hochwasserschutz: Entsiegelte Flächen, Retentionsräume und kluge Regenwasserbewirtschaftung entlasten Kanäle und vermeiden lokale Überflutungen.
- Wohnen und leistbare Flächen: Innenentwicklung nutzt bestehende Infrastruktur, spart Erschließungskosten und kann so langfristig Preise stabilisieren.
- Arbeitswege und Verkehr: Dichte, nutzungsgemischte Quartiere ermöglichen kürzere Wege, stärken Öffis, Rad- und Fußverkehr und senken Staukosten.
- Landwirtschaft und Ernährung: Der Erhalt fruchtbarer Böden sichert regionale Produkte, kurze Lieferketten und Versorgungssicherheit.
Für Betriebe bedeutet flächensparendes Bauen, bestehende Standorte zu modernisieren, Parkraum intelligent zu managen und Logistikprozesse auf Schiene, Rad und Kombiverkehr auszurichten. Gemeinden profitieren von geringeren Betriebskosten für lange Straßen, Leitungen und Kanäle. Landwirtinnen und Landwirte gewinnen Planungssicherheit, wenn Flächen nicht Stück für Stück zerschnitten werden. Und Anrainerinnen und Anrainer erleben, dass kompakte Orte mit Parks, Plätzen und Nahversorgung Aufenthaltsqualität schaffen.
Beispiele zeigen, wie das gelingt: eine leerstehende Fabrikhalle zum Kultur- und Gewerbestandort umnutzen statt Neubau am Ortsrand; Zwischennutzung von Brachen, um Quartiere schrittweise aufzuwerten; Parkplätze partiell entsiegeln und begrünen; Dachaufstockungen und Lückenschlüsse, wo Statik und Infrastruktur es zulassen; Mobilitätskonzepte, die Stellplätze teilen und Carsharing fördern, damit weniger Fläche dauerhaft gebunden wird.
Politische Optionen: Von der Obergrenze zum Werkzeugkasten
Die von drei Viertel der Befragten befürwortete Obergrenze beim Bodenverbrauch ist ein strategischer Fixpunkt, ersetzt aber nicht den Werkzeugkasten, der sie umsetzbar macht. Dazu zählen:
- Bodenschutz-Vertrag Bund–Länder: Gemeinsame Ziele, Kennzahlen, Monitoring, Berichtspflichten und, wo vertretbar, Sanktionen.
- Innenentwicklung vor Außenentwicklung: Verankerung in Landesgesetzen und kommunalen Leitbildern, Brachflächenmanagement, aktive Bodenpolitik.
- Ökologisierung des Steuersystems: Förder- und Abgabenreform, die Sanierung und Nachverdichtung begünstigt.
- Entsiegelung und Grüninfrastruktur: Programme zur Reduktion versiegelter Flächen und zur Aufwertung des Stadtgrüns.
- Verkehr und Raum zusammendenken: Öffi-Ausbau, Taktverdichtung, Radverkehr, kurze Wege als Baustein flächensparender Siedlungsentwicklung.
Ein realistischer Pfad könnte so aussehen: Zunächst ein politischer Grundsatzbeschluss für eine nationale Obergrenze, flankiert von Ländervereinbarungen. Danach die Festlegung transparenter Indikatoren, etwa jährliche Flächenbilanzen mit Entsiegelungsanteil. Gemeinden erhalten Beratung und Instrumente, um Widmungen zu überprüfen, Brachflächen zu aktivieren und Bebauungsdichten sinnvoll zu steigern. Wo neue Baugebiete unvermeidbar sind, setzen Ausgleichsmaßnahmen (Entsiegelung, Grünflächen, Wassermanagement) an. Begleitend werden umweltschädliche Subventionen evaluiert und angepasst, um Fehlanreize systematisch abzubauen.
Analyse der Umfrage im Licht politischer Prozesse
Die Umfrage signalisiert Rückenwind für strengere Regeln. Politisch ist relevant, dass die Zustimmungswerte über Altersgruppen und Bundesländer hinweg hoch sind. Das erleichtert Verhandlungen zwischen Bund und Ländern, mindert aber nicht die Komplexität im Detail: Baurecht, Raumordnung, Gemeindefinanzen, Verkehrsplanung und Bodenpolitik greifen ineinander. Ein Bodenschutz-Vertrag könnte hier Struktur schaffen, indem er Ziele mit Verantwortlichkeiten verbindet. Damit die Obergrenze wirkt, muss die Messung nachvollziehbar sein (Was gilt als verbraucht? Welche Rolle spielt Entsiegelung?) und die Steuerung an Entscheidungen auf Gemeindeebene andocken.
Zukunftsperspektive: Was in den nächsten fünf bis zehn Jahren möglich ist
Mit einer verbindlichen Obergrenze, wie sie drei Viertel der Befragten befürworten, lässt sich ein Pfad zur Trendumkehr festlegen. In den ersten Jahren stehen Bestandsaktivierung, Leerstandsreduktion und Brachflächenentwicklung im Vordergrund. Städte und Gemeinden gewinnen Erfahrung mit Instrumenten wie Nachverdichtungsleitfäden, Qualitätskriterien für Dichte (Grün, Mikroklima, soziale Infrastruktur) und kooperativer Bodenpolitik. Parallel wächst die Praxis der Entsiegelung: Parkplätze werden teilentsiegelt, Innenhöfe begrünt, versickerungsfähige Beläge gesetzt, kommunale Entsiegelungsfonds unterstützen private Projekte.
Mittelfristig verlagern sich Investitionen stärker in die Innenentwicklung. Öffentlicher Verkehr, Rad- und Fußwege werden so geplant, dass neue Quartiere ohne zusätzliche Straßenkilometer auskommen. Für Gewerbe entstehen kompaktere, mehrgeschossige Lösungen mit geringerer Stellplatzquote. In ländlichen Regionen gewinnen Ortskerne als Standorte für Wohnen, Nahversorgung und Dienstleistungen. Mit einer ökologisierten Steuerlandschaft werden Projekte, die Fläche sparen und Klimarisiken mindern, wirtschaftlich attraktiver. Gelingt die Koordination, könnten die Kosten für zersiedelungsbedingte Infrastruktur langsamer wachsen, die Hitze- und Überflutungsrisiken abnehmen und der Rückhalt in der Bevölkerung weiter steigen.
Gleichzeitig bleibt es wichtig, Zielkonflikte offen zu adressieren: Leistbarer Wohnraum, wirtschaftliche Entwicklung und Naturschutz müssen zusammengebracht werden. Dazu braucht es Qualität in der Planung, Beteiligung vor Ort und Evaluierungen, die nachjustieren, wenn Maßnahmen nicht greifen. Die Umfrage liefert dafür ein Mandat – sie ersetzt nicht den politischen Aushandlungsprozess, sondern stärkt ihn.
Zahlen nüchtern lesen: Was die Studie nicht sagt
Die market-Umfrage bildet Meinungen im November 2025 ab, keine Kausalitäten. Sie sagt nicht, welche Maßnahmen im Detail die breite Mehrheit bevorzugt, und sie ersetzt keine Wirkungsanalyse. Sie zeigt aber robuste Signale: breite Zustimmung zu strengeren Regeln, Unterstützung für eine Obergrenze und deutliche Skepsis, dass die bisherigen Anstrengungen ausreichen. Wer Politik gestalten will, kann darauf aufbauen – mit transparenten Zielen, breiter Einbindung und evidenzbasierten Maßnahmen.
Weiterführende Informationen und Quellen
- WWF Österreich, OTS-Presseaussendung zur Umfrage: zur Quelle
- WWF Österreich, Themenseite Bodenschutz: wwf.at
- Statistik Austria, Umwelt und Energie (Überblick): statistik.at
Fazit: Jetzt den Rückenwind für Bodenschutz nutzen
Die Umfrage im Auftrag des WWF legt einen klaren Befund offen: Eine deutliche Mehrheit in Österreich will strengere Maßnahmen gegen Bodenverbrauch und Bodenversiegelung sowie eine verbindliche Obergrenze. Hinter diesen Prozenten stehen Alltagserfahrungen mit Hitze, Überschwemmungen, verlorenen Ortskernen und steigenden Infrastrukturkosten. Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft haben es in der Hand, den Rückenwind zu nutzen: mit einem Bodenschutz-Vertrag von Bund und Ländern, der Innenentwicklung stärkt, Entsiegelung fördert, umweltschädliche Subventionen abbaut und Steuern ökologisch ausrichtet. Wie sehen Sie das in Ihrer Gemeinde? Teilen Sie Beobachtungen, bringen Sie sich in lokale Planungsprozesse ein und verfolgen Sie die weiteren Schritte – die relevanten Dokumente und Daten finden Sie über die verlinkten Quellen. So wird aus Zustimmung echte Veränderung.