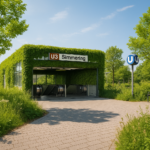3. November 2025: Österreichs Energiepreise geben im Monatsvergleich nach, bleiben im Jahresvergleich aber erhöht – und die nächsten Netzentgelte zeichnen ein differenziertes Bild. Was das für Haushalte in Wien, Salzburg, Niederösterreich, Tirol und dem Burgenland bedeutet, wird in den kommenden Wochen Diskussionen prägen. Der aktuelle Befund ist eindeutig, doch die Details sind komplex: Während Strom- und Gaspreise im September im Vergleich zu August gesunken sind, ziehen Heizenergieträger mit Beginn der Heizsaison an. Für Konsumentinnen und Konsumenten zählt jetzt zweierlei – kurzfristige Entlastung an der Zapfsäule und in den Abschlägen, aber auch mittelfristige Planungssicherheit vor dem Jahreswechsel 2025/26. Dieser Überblick ordnet die Energiepreise in Österreich ein, erklärt zentrale Begriffe und zeigt, worauf Haushalte achten sollten.
Energiepreise in Österreich: September-Trend und Ausblick 2026
Laut der Österreichischen Energieagentur verzeichnete der Energiepreisindex im September einen Rückgang von 0,6 Prozent gegenüber August. Treibstoffe sowie Strom- und Gaspreise gaben nach. Gleichzeitig stiegen die Energiepreise für Heizöl, Pellets und Brennholz mit Beginn der Heizsaison spürbar. Im Jahresvergleich bleibt Strom ein wesentlicher Preistreiber: Die Strompreise sanken im Monatsvergleich um 0,9 Prozent, lagen gegenüber dem Vorjahr aber immer noch um 35,9 Prozent höher. Erdgas verbilligte sich im Monatsvergleich um 1,5 Prozent und lag im Jahresvergleich um 1,9 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Energiepreise insgesamt lagen im September 2025 um 7,9 Prozent über dem September 2024, nach +5,9 Prozent im August-Vergleich.
Wichtig für den Blick nach vorne: Die Regulierungsbehörde hat den Entwurf der Netzentgelte für 2026 vorgelegt. Für Strom zeichnen sich regionale Unterschiede ab – mit sinkenden Entgelten in Städten wie Salzburg oder Wien, während Niederösterreich, Tirol und das Burgenland mit deutlichen Anstiegen rechnen müssen. Insgesamt wird ein leichter Anstieg der Stromnetzentgelte vorgeschlagen, der voraussichtlich unter der allgemeinen Inflation liegen dürfte. Bei Erdgas sollen die Netzentgelte österreichweit steigen; das wird die Inflation ab Jänner 2026 über das Gesamtjahr beeinflussen. Als Gründe nennt der Regulator rückläufige Absatzmengen und wegfallende Transiteinnahmen aus dem Erdgas-Transport.
Zahlen und Fakten im Überblick
- Energiepreisindex (EPI): -0,6 Prozent im Monatsvergleich (September vs. August).
- Strompreise: -0,9 Prozent im Monatsvergleich; +35,9 Prozent im Jahresvergleich.
- Erdgaspreise: -1,5 Prozent im Monatsvergleich; -1,9 Prozent im Jahresvergleich.
- Heizöl, Pellets, Brennholz: Preisanstieg zu Beginn der Heizsaison.
- Gesamtentwicklung: Energiepreise im September 2025 um 7,9 Prozent höher als im September 2024; im August-Vergleich lag der Vorjahresabstand bei +5,9 Prozent.
- Netzentgelte Strom 2026: regional uneinheitlich; insgesamt leichter Anstieg unter der allgemeinen Inflation erwartet.
- Netzentgelte Gas 2026: österreichweit im Anstieg; Einfluss auf die Inflation ab Jänner 2026 über das gesamte Jahr.
Was bedeutet der Energiepreisindex (EPI)?
Der Energiepreisindex, kurz EPI, ist ein Messinstrument, das die Preisentwicklung von für Haushalte relevanten Energieträgern bündelt. Er umfasst typischerweise Strom, Erdgas, Treibstoffe wie Benzin und Diesel sowie Heizenergieträger wie Heizöl, Pellets und Brennholz. Der EPI zeigt, ob die Energiepreise insgesamt steigen oder fallen, und macht Entwicklungen über verschiedene Energieträger vergleichbar. Für Konsumentinnen und Konsumenten ist er hilfreich, um die eigene Kostenlage einzuordnen. Ein Monatsrückgang kann kurzfristige Entlastung signalisieren, während eine höhere Jahresrate auf strukturelle Faktoren hindeutet, die länger wirken. Der EPI ist kein individueller Tarif, sondern ein statistischer Indikator, der Tendenzen beschreibt und eine Orientierung für Haushaltsbudgets bietet.
Was sind Netzentgelte?
Netzentgelte sind Gebühren, die für die Nutzung der Strom- und Gasnetze anfallen. Sie decken den Betrieb, die Instandhaltung und den Ausbau der Netzinfrastruktur, also Leitungen, Umspannwerke und Messsysteme. Netzentgelte werden von der Regulierungsbehörde genehmigt und sind regional unterschiedlich, weil die Kostenstruktur der Netzbetreiber variiert – zum Beispiel durch Siedlungsdichte, Topografie oder Investitionsbedarf. Für Endkundinnen und Endkunden machen Netzentgelte einen relevanten Anteil an der Gesamtrechnung aus, zusätzlich zu Energiekosten, Abgaben und Steuern. Wenn Netzentgelte steigen, kann die Rechnung zulegen, selbst wenn Beschaffungspreise oder Verbrauch stabil bleiben. Umgekehrt können sinkende Netzentgelte in einzelnen Regionen die Stromrechnung dämpfen.
Endkundenpreise verständlich erklärt
Endkundenpreise sind jene Preise, die Haushalte tatsächlich auf der Rechnung sehen. Sie setzen sich aus mehreren Bausteinen zusammen: Energie (Beschaffung), Netzentgelte, Abgaben und Steuern sowie gegebenenfalls Grundentgelte. Änderungen in einem Baustein können die Gesamtkosten verschieben. Steigen etwa Netzentgelte, kann das die Entlastung durch sinkende Energiepreise teilweise oder vollständig aufheben. In den vergangenen Monaten wirkten darüber hinaus ausgelaufene staatliche Unterstützungsmaßnahmen auf die Endkundenpreise: Mit dem Ende solcher Maßnahmen erhöhen sich die Rechnungen zunächst, dieser Basiseffekt fällt im Folgejahr aus der Jahresrate wieder heraus. Daher ist es möglich, dass Monatswerte sinken, während Jahresvergleiche noch hohe Zuwächse zeigen.
Inflation und Energiepreise: Zusammenhänge
Inflation beschreibt die allgemeine Teuerung von Waren und Dienstleistungen. Energiepreise spielen eine doppelte Rolle: Erstens fließen sie direkt in den Warenkorb der Statistik ein, etwa über Strom-, Gas- und Treibstoffkosten. Zweitens wirken sie indirekt, weil Unternehmen höhere Energiekosten häufig über ihre Preise weitergeben. Netzseitige Anpassungen – insbesondere bei Gas – können die Inflation zusätzlich beeinflussen, selbst wenn die reinen Beschaffungspreise stabil sind. Deshalb ist der Hinweis des Regulators wichtig, dass die Netzentgelte für Gas ab Jänner 2026 die Inflation über das gesamte Jahr beeinflussen werden. Für Haushalte bedeutet das: Budgetplanung sollte nicht nur die Energietarife, sondern auch mögliche Netz- und Abgabeneffekte berücksichtigen.
Heizsaison: Warum steigen manche Preise jetzt?
Mit Beginn der Heizsaison im Herbst steigt in Österreich die Nachfrage nach Heizenergieträgern wie Heizöl, Pellets und Brennholz. Dieser saisonale Effekt führt häufig zu Preisanpassungen, weil Händler Bestände aufbauen, Lieferketten auslasten und Beschaffungskosten sich verändern können. Auch Witterung und internationale Märkte spielen mit: Kalte Phasen erhöhen die Nachfrage, während globale Rohstoffpreise die Kalkulation beeinflussen. Daher ist es nicht ungewöhnlich, dass Heizenergieträger im Herbst teurer werden, obwohl Strom- oder Gaspreise kurzfristig nachgeben. Für Konsumentinnen und Konsumenten ist eine vorausschauende Planung sinnvoll – wer rechtzeitig kauft, kann Schwankungen glätten, während Last-Minute-Käufe in der Kälteperiode oft teuer sind.
Transiterlöse und Gasinfrastruktur: Worum geht es?
Transiterlöse entstehen, wenn Gas durch Österreich geleitet wird und Netzbetreiber für die Durchleitung Gebühren erhalten. Fallen diese Erlöse weg oder sinken, verteilen sich die Fixkosten der Infrastruktur auf weniger Durchleitungen und Endkundinnen und Endkunden. Gleichzeitig führen rückläufige Absatzmengen – also geringerer Gasverbrauch – dazu, dass fixe Netz- und Betriebskosten auf eine kleinere Menge verteilt werden müssen. Daraus können steigende Netzentgelte resultieren, selbst wenn die reinen Beschaffungspreise für Erdgas nicht steigen. Für die Preisbildung bedeutet das, dass strukturelle Faktoren die Energiepreise beeinflussen, die mit dem Marktpreis allein nicht erklärt werden können.
Geordneter Rückbau der Gasinfrastruktur: Bedeutung
Ein geordneter Rückbau der Gasinfrastruktur meint die langfristige Planung, wie Leitungen, Stationen und Anlagen angepasst, stillgelegt oder umgenutzt werden, wenn der Gasabsatz nachhaltig sinkt. Ziel ist es, Versorgungssicherheit, Kosteneffizienz und Klimaziele in Einklang zu bringen. Ohne Plan drohen Doppelbelastungen: hohe Fixkosten bei geringer Auslastung, die über Netzentgelte auf Haushalte wirken, und gleichzeitig Investitionsstaus. Ein geordneter Rückbau klärt, welche Netze systemrelevant bleiben, welche Regionen alternative Wärme- und Energielösungen benötigen und wie der Umbau sozialverträglich gestaltet wird. Für Konsumentinnen und Konsumenten ist das wichtig, weil strukturierte Prozesse Preisrisiken verringern und Planbarkeit erhöhen.
Historische Entwicklung der Energiepreise in Österreich
Die Energiepreise in Österreich haben seit der Pandemie mehrere Phasen durchlaufen. Nach einem Nachfrageeinbruch im Jahr 2020 folgte eine kräftige Erholung, die ab 2021/22 durch internationale Energiekrisen überlagert wurde. Lieferkettenprobleme, geopolitische Spannungen und Unsicherheiten am Gasmarkt ließen Großhandelspreise teils sprunghaft steigen. Für Haushalte kamen die Effekte zeitverzögert an, weil Verträge, Netz- und Abgabensysteme Preissignale dämpfen oder verzögern. Ab 2023 setzte eine Normalisierung auf den Großhandelsmärkten ein, doch die Endkundenpreise blieben erhöht, unter anderem wegen Netz- und Systemkosten sowie bereits eingepreister Risikozuschläge. Staatliche Unterstützungsmaßnahmen pufferten die Belastung eine Zeit lang ab. Mit deren Auslaufen zu Beginn des Jahres 2025 wurden Preisniveaus sichtbar, die ohne diese Hilfen gegolten hätten. Im Herbst 2025 zeigt sich nun ein gemischtes Bild: Im Monatsvergleich sinken Energiepreise in mehreren Segmenten, im Jahresvergleich sind die Niveaus – besonders bei Strom – aber noch deutlich höher. Diese Divergenz verweist auf Basis- und Sondereffekte, die mit dem kommenden Jahreswechsel auslaufen und in den Jahresraten nach und nach verschwinden. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Struktur der Netzentgelte an Bedeutung, weil sie das Preisgefüge abseits der Großhandelskurven stabil oder belastend beeinflussen kann.
Regionale Unterschiede und Vergleich mit Deutschland und der Schweiz
Für 2026 zeigen die Entwürfe zu den Stromnetzentgelten regionale Unterschiede: In Salzburg und Wien können Kundinnen und Kunden mit sinkenden Entgelten rechnen. In Niederösterreich, Tirol und im Burgenland steigen sie zum Jahreswechsel deutlich. Diese Unterschiede spiegeln regionale Kostenstrukturen, Investitionszyklen und Auslastung der Netze wider. Österreichweit wird ein leichter Anstieg der Stromnetzentgelte vorgeschlagen, der voraussichtlich unter der allgemeinen Inflation liegt. Bei Gas ist die Lage einheitlicher: Die Netzentgelte sollen österreichweit steigen und gelten als relevanter Treiber für die Inflation im Jahr 2026 – unabhängig von kurzfristigen Bewegungen der Beschaffungspreise.
Im Vergleich zu Deutschland und der Schweiz fällt auf: Die Systeme der Netzentgeltregulierung sind unterschiedlich ausgestaltet. In Deutschland spielen überregionale Umlagen und Abgaben eine starke Rolle, während die Schweiz die Preisbildung in einem stärker dezentralen, kantonalen Rahmen organisiert. Solche Strukturunterschiede erschweren eine 1:1-Übertragung von Trends. Gemeinsam ist den drei Ländern jedoch, dass Netzentgelte zunehmend als eigenständiger Preistreiber gesehen werden, der losgelöst von Großhandelskursen wirken kann. Für Haushalte in Österreich bleibt daher der regionale Blick entscheidend: Ob in Wien oder Salzburg leichte Entlastungen bei den Netzentgelten ankommen oder in Niederösterreich, Tirol und dem Burgenland höhere Entgelte anstehen, bestimmt die konkrete Rechnung stärker, als ein bloßer Blick auf den Großhandelsmarkt vermuten lässt.
Konkrete Auswirkungen für Haushalte
Für Haushalte bedeuten sinkende Energiepreise im Monatsvergleich noch keine Garantie für niedrigere Jahreskosten. Entscheidend ist, wie Energieversorger Preisbewegungen in den Tarifen weitergeben, wie sich Netzentgelte verändern und ob Abschläge angepasst werden. Wer mit Strom heizt, spürt Strompreise und Stromnetzentgelte unmittelbar. Für Haushalte mit Gasheizung rücken die Gasnetzentgelte ins Zentrum, da sie 2026 österreichweit steigen sollen. Wer mit Heizöl, Pellets oder Brennholz heizt, muss saisonale Spitzen einkalkulieren, insbesondere bei kurzfristiger Beschaffung zu Beginn der Heizsaison. Ein Beispiel aus der Praxis: Eine Familie in Wien profitiert möglicherweise von sinkenden Stromnetzentgelten, wodurch sich die Stromrechnung trotz schwankender Energietarife stabilisiert. In einem Einfamilienhaus in Niederösterreich hingegen kann die Stromrechnung zum Jahreswechsel steigen, obwohl der Verbrauch unverändert bleibt, weil die Netzentgelte dort anziehen. Gasnutzerinnen und Gasnutzer in allen Bundesländern sollten 2026 genau prüfen, ob ihre Abschläge noch passen, da netzseitige Erhöhungen einfließen.
Haushaltsplanung sollte daher mehrere Schritte umfassen: den eigenen Jahresverbrauch prüfen, Tarife vergleichen, Abschläge rechtzeitig anpassen und Spielräume für saisonale Spitzen einplanen. Zusätzlich lohnt ein Blick auf Effizienzmaßnahmen. Schon einfache Schritte wie das Optimieren der Heizkurve, das Abdichten von Fenstern und Türen oder die Nutzung programmierbarer Thermostate können den Bedarf senken. Wer investiert – etwa in Dämmung oder den Tausch alter Pumpen – reduziert die Abhängigkeit von Energiepreisen langfristig. Wichtig ist zudem die transparente Kommunikation mit dem Versorger: Welche Preisgarantien gelten? Wann werden Tarife angepasst? Gibt es regionale Besonderheiten bei den Netzentgelten? Antwortet der Anbieter klar, lassen sich Überraschungen minimieren.
Ausblick 2026: Was Haushalte erwarten könnten
Aus heutiger Sicht deutet die Kombination aus leicht sinkenden Energiepreisen im Monatsvergleich, hohen Vorjahreswerten und den angekündigten Anpassungen bei den Netzentgelten auf eine differenzierte Entwicklung hin. Bei Strom sind regionale Entlastungen möglich, vor allem dort, wo Netzentgelte fallen. Da der Vorschlag insgesamt einen leichten Anstieg unter der allgemeinen Inflation vorsieht, ist nicht mit einem überproportionalen Druck aus dieser Komponente zu rechnen. Zugleich bleiben die Jahresvergleiche bei Strom erhöht; der Basiseffekt aus dem Jahresbeginn 2025 wird mit dem Jahreswechsel jedoch auslaufen, was die Dynamik in den Jahresraten dämpfen könnte.
Bei Gas wird die Lage 2026 netzseitig anspruchsvoller: Die österreichweit steigenden Gasnetzentgelte werden nach Einschätzung des Regulators die Inflation ab Jänner 2026 über das gesamte Jahr beeinflussen. Hintergrund sind geringere Absatzmengen und wegfallende Transiterlöse. Für Haushalte kann das bedeuten, dass Gasrechnungen steigen, selbst wenn die Beschaffungspreise stabil bleiben. Perspektivisch rückt die strukturelle Frage in den Mittelpunkt, wie die Gasinfrastruktur an einen sinkenden Verbrauch angepasst werden kann. Je klarer der Umbau geplant wird, desto besser lassen sich Kostenschocks vermeiden. Haushalte sollten daher die Kommunikation ihrer Netz- und Energielieferanten aufmerksam verfolgen und Spielräume durch Effizienzmaßnahmen nutzen.
Expertenstimme
Zur Lage am Gasmarkt und zu den Netzentgelten erläutert Lukas Zwieb, Energieexperte der Österreichischen Energieagentur: „Konsequenterweise zeigt das die Notwendigkeit zur Entwicklung von Konzepten für einen geordneten Rückbau der Gasinfrastruktur auf.“ Der Hinweis macht deutlich, dass die Energiepreise nicht nur von kurzfristigen Marktbewegungen abhängen, sondern auch von langfristigen Strukturentscheidungen. Planung, Regulierung und Investitionen wirken hier zusammen und prägen die Energiekosten der nächsten Jahre.
Tipps und Links für vertiefende Information
Wer seine Energiepreise in Österreich besser einordnen möchte, findet hier weiterführende Inhalte und serviceorientierte Übersichten:
- Strompreis-Entwicklung in Österreich: Hintergründe und Trends
- Gastarife vergleichen: Worauf Haushalte achten sollten
- Heizen mit Pellets und Brennholz: Kostenfaktoren im Überblick
- Energiesparen im Haushalt: Praktische Maßnahmen mit Wirkung
Quelle: Österreichische Energieagentur – Austrian Energy Agency, OTS-Presseaussendung „Energiepreise im September: Rückgang im Monatsvergleich“ vom 3. November 2025. Zum Originaltext: ots.at.
Fazit und Einordnung
Die Energiepreise in Österreich zeigen im September ein geteiltes Bild: kurzfristige Entlastung bei Strom, Gas und Treibstoffen, anziehende Preise bei Heizöl, Pellets und Brennholz. Im Jahresvergleich bleibt Strom ein Preistreiber, obwohl die Monatswerte nachgeben. Für 2026 gilt: Die Stromnetzentgelte entwickeln sich regional unterschiedlich, insgesamt jedoch moderat. Bei Gas ist mit höheren Netzentgelten zu rechnen, die die Inflation über das Jahr beeinflussen können. Für Haushalte bedeutet das: Tarife prüfen, Abschläge anpassen, Effizienzpotenziale heben – und die angekündigten Netzentgelte genau im Blick behalten.
Wie erleben Sie die aktuellen Energiepreise in Österreich? Teilen Sie Erfahrungen und Fragen mit Ihrer Community und informieren Sie sich regelmäßig über regionale Netzentgelte und Tarifänderungen. Weitere Hintergründe, Analysen und Serviceartikel finden Sie in den verlinkten Ressourcen und direkt bei der Österreichischen Energieagentur. So bleiben Entscheidungen fundiert – und die nächste Jahresabrechnung planbarer.