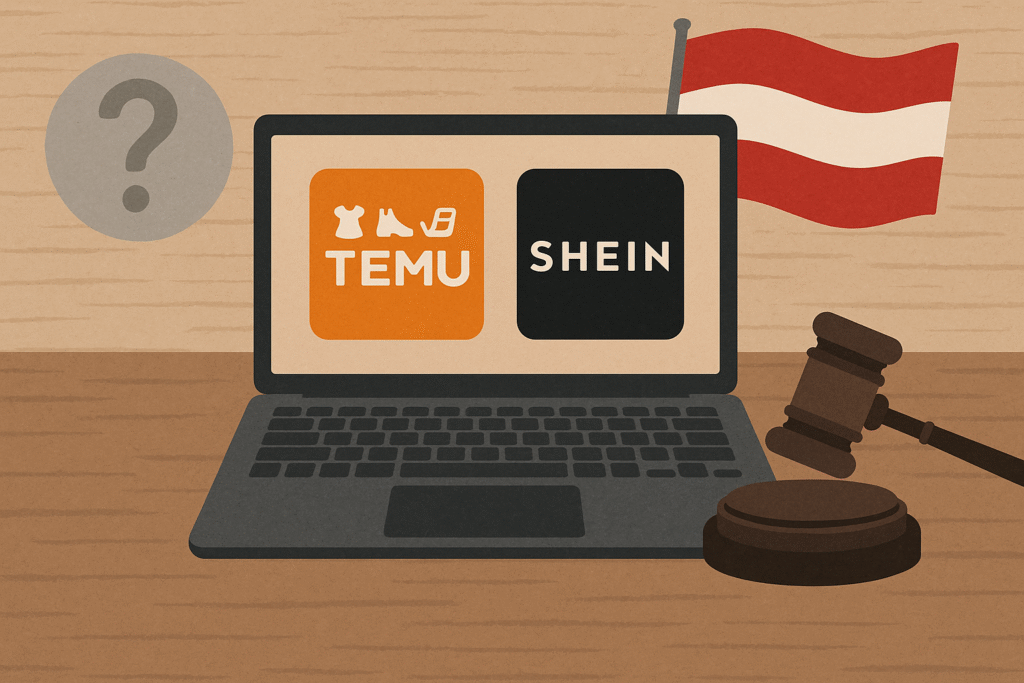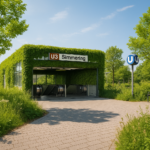Analyse zu Temu und Shein: Warum Plattformhaftung, REACH und Verbraucherschutz in Österreich jetzt relevant sind. Am 5. November 2025 rücken neue Testergebnisse von Global 2000 und der AK Oberösterreich die Risiken von Billigimporten erneut ins Rampenlicht. Was nach Schnäppchen aussieht, kann nachteilige Folgen haben: für Gesundheit, für heimische Arbeitsplätze und für fairen Wettbewerb. Der Handelsverband sieht ein strukturelles Problem, das weit über Einzelfälle hinausreicht. Die politische Debatte über Plattformhaftung, Produktsicherheit und korrekte Deklaration läuft, doch die Praxis im Onlinehandel hat sich in den letzten Jahren schneller verändert als die Kontrolle. Österreich steht damit vor einer Richtungsentscheidung, die Konsumentinnen und Konsumenten ebenso betrifft wie Händlerinnen und Händler und die Kommunen, die auf verlässliche Steuereinnahmen angewiesen sind.
Plattformhaftung im Onlinehandel: Was die Zahlen bedeuten
Die vom Handelsverband aufgegriffenen Analysen von Global 2000 und der AK Oberösterreich verweisen auf bedenkliche Funde in Produkten der Plattformen Temu und Shein. Laut Darstellung des Handelsverbands überschritt eine untersuchte Damenjacke den EU-Grenzwert für sogenannte Ewigkeitschemikalien um ein Vielfaches. Der Verband spricht von einem kriminellen Massenphänomen, weil Sicherheitsauflagen, Zölle und Steuern bei Billigimporten aus Drittstaaten vielfach unterlaufen würden. Diese Aussagen sind Positionen des Handelsverbands und wurden öffentlich gemacht; sie zeigen den Konflikt zwischen Konsumentenschutz, fairer Wettbewerbsordnung und dem schnellen Wachstum globaler Marktplätze.
Die vorgelegten Zahlen sind bemerkenswert: Im Vorjahr flossen laut Handelsverband 4,6 Milliarden Kleinstpakete mit einem Warenwert unter 150 Euro nahezu ungeprüft in den EU-Binnenmarkt. Rein rechnerisch entspricht das rund zehn Paketen pro EU-Bürgerin oder EU-Bürger. In Österreich liegt Temu im Marktplatzranking mit 341 Millionen Euro Umsatz bereits auf Rang vier, Shein mit 217 Millionen Euro auf Rang sieben. Zugleich wird ausgeführt, dass laut EU-Spielzeugverband ein Großteil bestimmter Billigspielzeuge unsicher sei. Diese Angaben dienen der Einordnung, entscheidend bleibt jedoch die korrekte Auslegung der EU-Regelwerke und deren wirksame Durchsetzung.
Fachbegriff erklärt: Ewigkeitschemikalien PFAS
Ewigkeitschemikalien, oft als PFAS bezeichnet, sind eine Gruppe von industriell hergestellten Substanzen, die wasser-, fett- und schmutzabweisend wirken. Der Begriff Ewigkeitschemikalien verweist auf ihre enorme Stabilität in Umwelt und Organismus. PFAS finden sich unter anderem in Outdoor-Bekleidung, Kochgeschirrbeschichtungen oder Verpackungen. Das Problem: Viele PFAS bauen sich kaum ab, reichern sich in Nahrungsketten an und stehen im Verdacht, gesundheitliche Risiken zu bergen. Die EU setzt deshalb Grenzwerte und arbeitet an weiteren Einschränkungen. Für Konsumentinnen und Konsumenten heißt das: Produkte ohne nachvollziehbare Materialangaben und ohne anerkannte Sicherheitskennzeichen können ein erhöhtes Risiko tragen.
Fachbegriff erklärt: Plattformhaftung
Plattformhaftung bezeichnet die rechtliche Verantwortung von Online-Marktplätzen für Angebote, die über ihre Infrastruktur verkauft werden. Dabei geht es nicht um die Rolle als Verkäuferin oder Verkäufer, sondern um die Pflicht, Sorgfalts- und Prüfprozesse zu etablieren, damit Produkte korrekt deklariert, sicher und regelkonform sind. Eine wirksame Plattformhaftung bedeutet, dass Marktplätze beim Verstoß von Drittanbietern nicht bloß Vermittler sind, sondern für Meldung, Entfernung, Sperren und gegebenenfalls Schadenminderung verantwortlich gemacht werden können. In Österreich wird dieses Prinzip bereits bei der Verpackungsentsorgung angewandt, indem Plattformen für die korrekte Lizenzierung und Entsorgung mitverantwortlich gemacht werden.
Fachbegriff erklärt: CE-Kennzeichnung
Die CE-Kennzeichnung ist kein Qualitäts- oder Gütesiegel, sondern ein Rechtskonformitätszeichen. Herstellerinnen und Hersteller erklären damit, dass ihr Produkt die einschlägigen EU-Richtlinien erfüllt, etwa bei Sicherheit, Gesundheitsschutz oder Umweltschutz. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist CE ein Mindeststandard, kein Qualitätsversprechen. Fehlt die Kennzeichnung oder ist sie offensichtlich missbräuchlich verwendet, liegt ein Warnsignal vor. Händlerinnen und Händler im EU-Raum sind verpflichtet, keine Produkte ohne erforderliche Konformität in Verkehr zu bringen. Für Marktplätze ergibt sich daraus eine Prüf- und Sorgfaltspflicht, um systematische Umgehungen einzudämmen.
Fachbegriff erklärt: UWG-Beschwerde
Eine UWG-Beschwerde stützt sich auf das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Darin werden Praktiken untersagt, die Wettbewerb verzerren, Konsumentinnen und Konsumenten irreführen oder Mitbewerberinnen und Mitbewerber unzulässig benachteiligen. Wird eine UWG-Beschwerde bei einer Behörde oder einem Gericht eingebracht, prüft diese Stelle, ob beispielsweise irreführende Preisangaben, falsche Deklarationen oder aggressive Verkaufsmethoden vorliegen. Der Handelsverband hat nach eigener Angabe bereits 2024 eine entsprechende Beschwerde gegen Temu bei der Bundeswettbewerbsbehörde eingebracht. Damit ist noch keine Entscheidung verbunden, sondern ein Prüf- und Ermittlungsprozess.
Fachbegriff erklärt: Kleinstpakete unter 150 Euro
Kleinstpakete unter 150 Euro sind Sendungen, deren Warenwert die Schwelle für zollfreie Einfuhr unterschreitet. Während Einfuhrumsatzsteuer in der EU grundsätzlich auch für Kleinbeträge relevant ist, bleibt die Zollfreigrenze bis 150 Euro bestehen. Das führt zu komplexen Abläufen, denn die wahre Wertangabe und korrekte Deklaration sind schwer zu kontrollieren, wenn Milliarden Pakete den Binnenmarkt erreichen. Falschangaben können den Preis künstlich senken und Kontrollen erschweren. Plattformen und Logistikpartner stehen daher in der Pflicht, korrekte Daten bereitzustellen, um die Einhaltung von Steuer- und Sicherheitsvorschriften zu sichern.
Fachbegriff erklärt: REACH und Produktsicherheit
REACH ist die zentrale EU-Chemikalienverordnung für Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe. Herstellerinnen, Importeure und Händlerinnen müssen Informationen über Stoffe entlang der Lieferkette weitergeben und Gefahren minimieren. Parallel gilt die europäische Produktsicherheitsarchitektur mit der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung, die Marktüberwachungsbehörden stärkt und Onlineverkäufe explizit adressiert. Für Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet das: Produkte auf dem EU-Markt sollten sicher und nachvollziehbar sein. Bei Marktplätzen mit Drittstaaten-Anbietern hängt die Wirksamkeit jedoch von der konsequenten Durchsetzung und von Haftungsregeln ab, die Schlupflöcher schließen.
Historische Entwicklung: Vom Nischenhandel zum globalen Massenmarkt
Der Onlinehandel hat sich in Europa binnen zwei Jahrzehnten vom Nischenkanal zum Massenmarkt entwickelt. Marktplätze, die Millionen Händlerinnen und Händler aus aller Welt verbinden, wurden zum Standard. Diese Dynamik traf auf Regulierungen, die ursprünglich eher für stationäre oder nationale Handelsmodelle konzipiert waren. Schrittweise zog der Gesetzgeber nach: Die EU hat die Mehrwertsteuerregeln reformiert, damit auch Kleinsendungen grundsätzlich erfasst werden, und mit dem Digital Services Act klare Sorgfalts- und Transparenzpflichten für Plattformen geschaffen. Parallel entstand mit der Marktüberwachungsverordnung ein Instrument, um Behörden besser zu vernetzen und gefährliche Produkte schneller aus dem Verkehr zu ziehen.
Dennoch blieb eine Lücke: Die schiere Menge an Kleinstpaketen, die Verlagerung von Verantwortung in komplexen Lieferketten und aggressive Preismodelle, die auf Kostenvorteile außerhalb der EU setzen, erschweren die wirksame Kontrolle. Österreich hat bereits einzelne Hebel gesetzt, etwa bei der Verpackungsentsorgung mit einer Mitverantwortung von Plattformen. Der Handelsverband fordert, dieses Haftungsprinzip auf Warenkennzeichnung und Steuern auszudehnen. Die aktuellen Testergebnisse von Global 2000 und der AK Oberösterreich liefern den Anstoß, diese Debatte zu intensivieren und auf eine praxistaugliche Lösung zuzusteuern, die Konsumentenschutz, faires Wettbewerbsumfeld und die Digitalisierung des Handels verbindet.
Vergleich: Österreich, Deutschland, Schweiz
Im DACH-Raum verfolgen die Länder ähnliche Ziele, setzen aber unterschiedliche Akzente. Österreich betont die Mitverantwortung von Marktplätzen bereits im Bereich der Verpackung und diskutiert eine nationale Plattformhaftung für korrekte Warendeklaration und Versteuerung. Deutschland hat früh mit Haftungsregeln für Marktplätze bei Umsatzsteuer und Verpackung nachgeschärft. Händlerinnen und Händler müssen in Register eingetragen sein, sonst drohen Sperren. Marktplätze werden in die Pflicht genommen, Nachweise zu prüfen und gegebenenfalls Angebote zu deaktivieren. Diese Mechanismen erhöhen die Compliance, sind in der Praxis aber auf konsequente Durchsetzung und Datenaustausch angewiesen.
Die Schweiz ist kein EU-Mitglied und organisiert Chemikalienrecht, Zoll und Produktsicherheit eigenständig. Gleichwohl steht sie vor ähnlichen Herausforderungen im Cross-Border-E-Commerce. Schweizer Post- und Zollprozesse haben die Abfertigung von Kleinsendungen digitalisiert, dennoch bleibt die Kontrolle einzelner Pakete begrenzt. Aus Konsumentensicht ist der Schutzgedanke vergleichbar, aber Rechtsdurchsetzung über Grenzen hinweg bleibt anspruchsvoll. Der gemeinsame Nenner im DACH-Raum lautet daher: Ohne klare Haftung der Marktplätze, ohne digitale Herkunftsnachweise und ohne robuste Marktaufsicht lassen sich Risiken nicht nachhaltig eindämmen.
Konkrete Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger
Für Konsumentinnen und Konsumenten steht die Produktsicherheit im Vordergrund. Wer über Drittstaaten-Plattformen bestellt, hat oft geringere Transparenz über Materialien, Prüfsiegel und Rückgabewege. Bei Kinderartikeln, Elektronik mit Netzanschluss oder Kosmetik kann das Sicherheitsrisiko höher sein, wenn Mindeststandards nicht eingehalten werden. Ein Beispiel aus dem Alltag: Ein vermeintlich günstiges Kinderspielzeug ohne verlässliche Kennzeichnung kann gefährliche Weichmacher enthalten. Ein Netzteil mit mangelhafter Isolation kann überhitzen. Der Verzicht auf nachvollziehbare Konformitätsunterlagen erschwert Gewährleistung und Rückruf.
Auch Gemeinden sind betroffen. Der Handelsverband verweist darauf, dass falsch deklarierte Pakete Kommunalsteuern entziehen können. Weniger Einnahmen engen Spielräume für lokale Infrastruktur, Bildung oder Pflege ein. Gleichzeitig belastet Verpackungsmüll die Entsorgungssysteme. Für Händlerinnen und Händler in Österreich entsteht ein Wettbewerbsnachteil, wenn sie nachweislich alle Regeln erfüllen, während systematische Unterdeklaration oder fehlende Verantwortung auf Plattformen Preisdruck erzeugt. Langfristig gefährdet das lokale Arbeitsplätze, Innovationskraft und die Finanzierung von Ausbildungsplätzen im Handel.
Was können Einzelne tun Die erste Regel lautet, bewusst einzukaufen. Achten Sie auf CE-Kennzeichnung, klare Materialangaben und vollständige Anbieterinformationen. Prüfen Sie, ob ein Impressum, eine gültige Adresse im EU-Raum und ein transparenter Rückgabeprozess vorhanden sind. Für riskoreiche Produktgruppen, etwa Spielzeug oder Elektronik, lohnt sich der Kauf bei Anbietern mit dokumentierter Konformität. Orientierung bieten zudem unabhängige Tests und Warnmeldungen der Marktaufsicht.
Zahlen und Fakten im Detail
Die Zahl von 4,6 Milliarden Kleinstpaketen unter 150 Euro, die in den EU-Binnenmarkt gelangten, zeigt die Dimension. Rein rechnerisch entspricht das bei rund 450 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern etwa zehn Paketen pro Person. Im österreichischen Marktplatzranking verzeichnen Temu 341 Millionen Euro und Shein 217 Millionen Euro Umsatz. Zusammengenommen nähert sich das Volumen großen, etablierten Plattformen an. Der Handelsverband weist zudem auf einen sehr hohen Anteil unsicherer Spielzeuge hin, die auf bestimmten Plattformen angeboten werden. Das unterstreicht den Bedarf an konsequenter Marktaufsicht und an Haftungsstrukturen, die Missbrauch unrentabel machen.
Auf der Einnahmenseite stehen Mehrwertsteuer und Zölle. Die EU hat die Steuerbefreiung für Kleinsendungen abgeschafft, die Zollfreigrenze von 150 Euro gilt jedoch weiterhin. Das setzt Anreize für korrekte elektronische Voranmeldungen und für digitale Systeme, die Produktdaten und Rechnungswerte plausibilisieren. Werden 50 Euro bezahlt, dürfen nicht 20 Euro am Dokument stehen. Genau hier setzen Forderungen nach Plattformhaftung an: Marktplätze sollen durch Prüfmechanismen und Datenanalysen sicherstellen, dass Rechnungswert, Warenbeschreibung und Klassifizierung stimmen. So ließe sich Steuer- und Deklarationsbetrug systematisch eindämmen.
Rechtlicher Rahmen: DSA, GPSR und Marktaufsicht
Der Digital Services Act bringt Sorgfalts- und Transparenzpflichten für Plattformen, etwa Melde- und Abhilfeverfahren bei gefährlichen Produkten. Die allgemeine Produktsicherheitsverordnung stärkt Marktaufsicht, Rückverfolgbarkeit und digitale Produktinformationen. REACH setzt Grenzen und Informationspflichten für Chemikalien. Zusammengenommen bieten diese Instrumente eine solide Basis. Entscheidend ist die Umsetzung: Risikobasierte Kontrollen, Datenzugang für Behörden und klare Haftungsregeln für Marktplätze sind nötig, um die Lücke zwischen Regeltext und Praxis zu schließen. Österreich kann über nationale Ergänzungen, insbesondere bei Deklaration und Steuern, nachschärfen und zugleich EU-weit koordinierte Maßnahmen unterstützen.
Praxisbeispiele und Alltagscheck
- Spielzeugkauf: Achten Sie auf Alterskennzeichnung, CE, Warnhinweise und Herstellerangaben. Fehlende Daten sind ein Warnsignal.
- Bekleidung: Bei Funktionskleidung ohne Materialangaben oder bei intensiver Geruchsbelastung ist Vorsicht angebracht.
- Elektronik: Netzteile, Ladegeräte und Akkus sollten Prüfzeichen und eine nachvollziehbare Konformitätserklärung haben.
- Rückgabe: Prüfen Sie Rücksendeadresse, Kosten und Bearbeitungszeiten. EU-Rücksendeadressen sind ein Plus.
Politikoptionen auf einen Blick
- Nationale Plattformhaftung für Warendeklaration und Steuern mit klaren Prüfpflichten und Sanktionen bei Wiederholung.
- Verstärkte Datenkooperation zwischen Plattformen, Zoll und Marktaufsicht zur Erkennung systematischer Falschangaben.
- Risikobasierte Stichproben mit digitaler Vorabklassifizierung, um gefährliche Produktkategorien priorisiert zu prüfen.
- Transparenzpflichten für Marktplätze zu Sperrungen, Rückrufen und Prüfresultaten, um Vertrauen zu schaffen.
Zukunftsperspektive: Wie es weitergehen könnte
Der Trend ist eindeutig: Onlinehandel wächst weiter, Lieferketten werden datengetriebener und grenzüberschreitender. Für Österreich eröffnet das Chancen im Export und in der Logistik, verlangt aber zugleich robuste Schutzmechanismen. Kurzfristig könnte eine nationale Plattformhaftung den größten Hebel bringen, da sie an der Quelle ansetzt. Wenn Marktplätze für korrekte Deklarationen und Steuerabführung mitverantwortlich sind, reduziert sich der Vorteil unsauberer Anbieter. Mittel- bis langfristig werden harmonisierte EU-Maßnahmen, etwa einheitliche Datenschnittstellen, digitale Produktpässe und KI-gestützte Risikoanalysen, die Kontrolle von Massenströmen verbessern.
Entscheidend wird die Balance: Innovation nicht ausbremsen, aber klare Leitplanken setzen. Für Konsumentinnen und Konsumenten bedeuten stärkere Pflichten für Plattformen mehr Sicherheit und Transparenz. Für heimische Händlerinnen und Händler bedeuten sie fairere Wettbewerbsbedingungen. Und für die öffentliche Hand können verlässliche Deklarationen Mehreinnahmen sichern, die in wichtige Aufgaben fließen. Österreich kann in diesem Feld eine Vorreiterrolle einnehmen, wenn Recht, Aufsicht und digitale Umsetzung ineinandergreifen.
Weiterführende Informationen und Quellen
Ausführliche Presseaussendung des Handelsverbands mit Verweis auf Global 2000 und AK Oberösterreich: ots.at Presseaussendung
Hintergründe und Dossiers bei uns: Schwerpunkt E-Commerce, Thema Verbraucherschutz, Dossier Handelsverband, Online-Marktplatz und Regulierung
Wichtiger Hinweis: Alle Zahlen und Bewertungen zu Temu, Shein und Marktentwicklungen in diesem Beitrag beruhen auf der genannten Quelle des Handelsverbands sowie den darin referenzierten Untersuchungen. Rechtliche Einordnungen erfolgen allgemein und ersetzen keine Rechtsberatung.
Fazit und Ausblick
Österreich steht am 5. November 2025 vor einer Weichenstellung im Onlinehandel. Die vom Handelsverband aufgegriffenen Testergebnisse bilden einen klaren Anlass, Plattformhaftung, REACH-Compliance und Produktsicherheit entschlossen weiterzuentwickeln. Für die Bevölkerung zählt der Schutz vor gefährlichen Stoffen und unsicheren Produkten. Für Unternehmen zählt ein fairer Markt, in dem Regeln gelten und kontrolliert werden. Für Gemeinden zählt ein verlässliches Steuerfundament, das Investitionen in das Gemeinwohl ermöglicht.
Die Debatte sollte nun faktenbasiert geführt werden. Welche Prüfpflichten sind verhältnismäßig Welche Sanktionen wirken präventiv Wie können Datenflüsse zwischen Plattformen und Behörden effizient gestaltet werden Wir werden die Diskussion begleiten und Entwicklungen einordnen. Wer sich tiefer informieren will, findet Hintergründe in unseren Themenbereichen und in der verlinkten Quelle. Bleiben Sie informiert und prüfen Sie beim Einkauf bewusst, ob Sicherheit, Transparenz und Fairness gewährleistet sind.