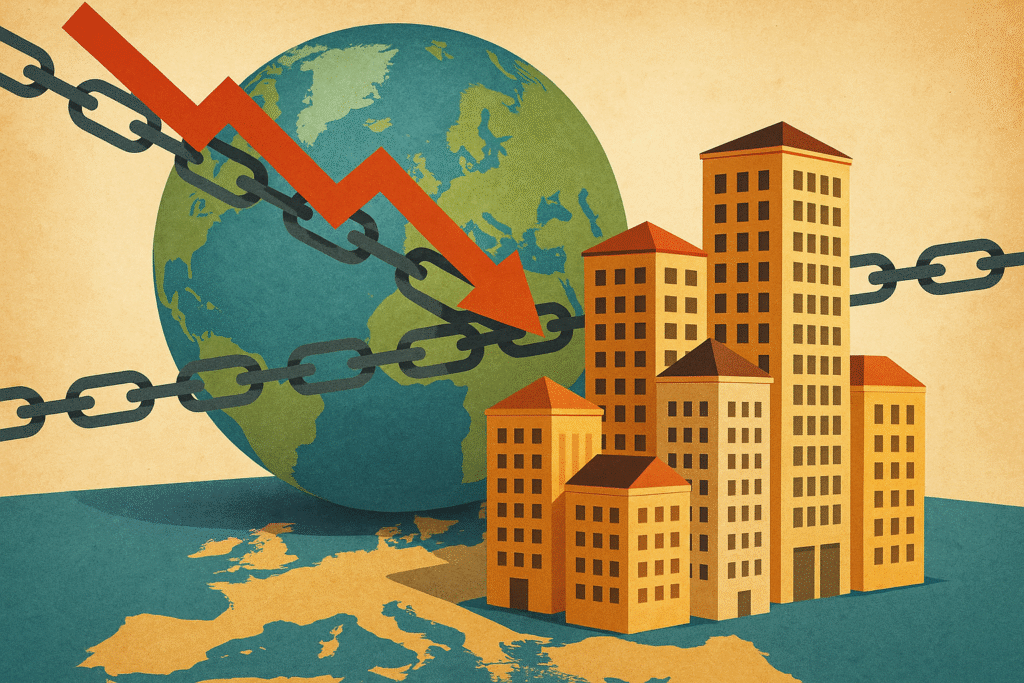Österreichs Immobilienmarkt blickt am 26. November 2025 mit Spannung nach Europa: Eine neue PwC/ULI-Analyse weist die Deglobalisierung als zentrales Risiko aus, während Wien im Städteranking zurückfällt und alternative Anlagen gewinnen. Was das für Investitionen, Mieten und Neubau bedeutet, zeichnet sich ab, doch entscheidend wird sein, wie die Branche auf Kosten-, Regulierungs- und Technologiedruck reagiert.
Deglobalisierung als Risiko für den Immobilienmarkt in Österreich
Die Studie ‚Emerging Trends in Real Estate 2026‘ von PwC in Kooperation mit dem Urban Land Institute zeigt, wie sich geopolitische Spannungen, Finanzierungskosten und der Druck auf leistbaren Wohnraum auf Europas Immobilienmärkte auswirken. Für Österreich ist die Botschaft klar: Die internationalen Kapitalströme werden selektiver, Transaktionen komplexer, und Wien rutscht in der Attraktivität für Investitionen auf Platz 17. Damit rücken langfristige Trends wie Digitalisierung, Dekarbonisierung und Demografie noch stärker in den Fokus strategischer Entscheidungen.
Unsere Auswertung basiert auf der Originalaussendung von PwC Österreich GmbH sowie der verlinkten Studie. Sie liefert Einordnung, Vergleich und Ausblick, ohne zu skandalisieren, und folgt den österreichischen Presserat-Richtlinien mit klarer Quellenlage.
Zahlen und Fakten aus der PwC/ULI-Studie
- Rund 70 Prozent der befragten Immobilienexpertinnen und -experten beurteilen die Folgen der Deglobalisierung kritisch – mehr als doppelt so viele wie vor zwei Jahren.
- Geopolitische Unsicherheit sehen 90 Prozent als zentrale Herausforderung, der Druck auf leistbaren Wohnraum rangiert mit 79 Prozent an zweiter Stelle.
- Alternative, infrastrukturähnliche Assetklassen wie Rechenzentren und neue Energieinfrastruktur führen die Sektorrankings an – trotz bislang geringerer Kapitalzuflüsse.
- Städteranking: London, Madrid und Paris vorne; Wien fällt von Platz 13 auf 17. Als Gründe werden schwache Konjunkturaussichten und regulatorische Unsicherheiten im Wohnsegment genannt.
- Künstliche Intelligenz: 75 Prozent der Unternehmen nutzen bereits KI-Lösungen (2024: 51 Prozent). In den nächsten 18 Monaten sollen KI-Anwendungen in Vermietung (90 Prozent), Objektmanagement (87 Prozent), Planung (84 Prozent) und Asset Management (86 Prozent) zum Einsatz kommen.
- ESG: Nur noch 21 Prozent sehen ESG als strategischen Haupttreiber der nächsten fünf Jahre (Vorjahr: 40 Prozent). Dekarbonisierung bleibt jedoch zentral; die Verbindung von ESG-Leistung und Wertsteigerung wird stärker eingefordert.
- Basis: 1.276 Befragte aus ganz Europa; Datenerhebung über Umfragen, Interviews und Round-Table-Gespräche.
Quelle: PwC Österreich GmbH via OTS, vollständige Studie.
Fachbegriff erklärt: Deglobalisierung
Deglobalisierung beschreibt die Tendenz, weltweite Verflechtungen in Handel, Kapital und Lieferketten zurückzufahren oder neu zu ordnen. Für die Immobilienwirtschaft heißt das: Kapitalsammelstellen investieren selektiver, Cross-Border-Deals werden seltener oder teurer, und die Risikoaufschläge zwischen Regionen driften auseinander. Projekte benötigen mehr Vorlauf für Regulierung und Compliance, Partnernetzwerke werden regionaler. Für Österreich bedeutet das eine stärkere Betonung lokaler Fundamentaldaten, etwa Kaufkraft, Beschäftigung und Demografie, statt reiner Arbitrage über internationale Kapitalströme.
Fachbegriff erklärt: Core-Segmente
Core-Segmente sind klassische, risikoarme Immobilienanlagen mit stabilen Mieterträgen in sehr guten Lagen, etwa hochwertige Wohn- oder Büroobjekte mit langen Mietverträgen und bonitätsstarken Mietparteien. Die Renditen sind meist niedriger, dafür ist die Ausschüttung stabil. In einem Umfeld höherer Zinsen und unsicherer Konjunktur geraten Core-Objekte unter Bewertungsdruck, wenn die Finanzierung teurer wird. Gleichzeitig bleiben sie ein Anker für institutionelle Anlegerinnen und Anleger, die Wert auf Werterhalt und planbare Cashflows legen. Das aktuelle Kapital wandert teilweise in operativere Segmente, doch Core behält seine Rolle als Stabilitätsbaustein.
Fachbegriff erklärt: Assetklassen
Assetklassen bezeichnen unterschiedliche Anlagekategorien wie Wohnen, Büro, Logistik oder Retail. Daneben existieren Spezial- oder Nischenklassen: Rechenzentren, Gesundheitsimmobilien, Studentenwohnen, Mikro-Wohnen oder Energieinfrastruktur. Jede Klasse folgt eigenen Nachfrage- und Risikotreibern, von Mieterbonität und Regulierung bis zu technologischen Trends. Strategien variieren: Value-Add (aktive Wertsteigerung), Core (stabilitätsorientiert) oder Opportunistic (höheres Risiko). Für Österreich gewinnt die Mischung mehr Gewicht: Anlegerinnen und Anleger verteilen Risiken zwischen Wohnimmobilien, Logistiknähe und infrastrukturähnlichen Nutzungen, um Zins- und Konjunkturzyklen besser auszugleichen.
Fachbegriff erklärt: Rechenzentren
Rechenzentren sind Immobilien, die IT-Infrastruktur aufnehmen: Server, Speicher, Kühlung, Notstrom, Netzwerk. Sie profitieren vom Datenwachstum durch Cloud, Streaming, KI und IoT. Für Investorinnen und Investoren sind sie attraktiv, weil die Nachfrage mit der Digitalisierung strukturell wächst und Nutzerinnen und Nutzer oft langfristige Verträge schließen. Herausforderungen sind Stromverfügbarkeit, Kühlung, Netzanschlüsse, Standortpolitik und Genehmigungen. In Europa entstehen Cluster in Metropolregionen mit hoher Netzkapazität. Österreich kann punkten, wenn erneuerbare Energie, Netzausbau und Flächenverfügbarkeit zusammenspielen.
Fachbegriff erklärt: Energieinfrastruktur
Energieinfrastruktur umfasst Assets entlang der Versorgungskette: Netze, Umspannwerke, Speicher, Ladehubs, erneuerbare Erzeugung nahe Verbrauchszentren. Immobilien nahe solcher Knoten profitieren von gesicherter Energieverfügbarkeit und Standortqualität. Investorinnen und Investoren bewerten diese Objekte als infrastrukturähnlich, weil die Erträge oft stabil sind und gesellschaftlichen Nutzen stiften. Die Herausforderung liegt in der Koordination mit Netzbetreibern, Förderlogik und langfristigen Regulierungsrahmen. Für Österreichs Städte heißt das: Quartiere mit eigener Energieerzeugung, niedrigem Verbrauch und smartem Lastmanagement gewinnen an Attraktivität.
Fachbegriffe erklärt: ESG und Dekarbonisierung
ESG steht für Environment, Social, Governance und bündelt ökologische, soziale und Führungsanforderungen an Unternehmen und Assets. Für Gebäude betrifft das Energieeffizienz, Emissionen, Materialien, Kreislaufwirtschaft, aber auch Nutzerwohl und Transparenz. Dekarbonisierung meint die systematische Reduktion von CO2-Emissionen über den Lebenszyklus: Bau, Betrieb, Sanierung, Rückbau. Für Anlegerinnen und Anleger ist ESG nicht nur Wert, sondern Risiko- und Renditefaktor: Regulatorische Vorgaben, Finanzierungskosten und Mieterpräferenzen beeinflussen Bewertungen. Auch wenn weniger Befragte ESG als Haupttreiber nennen, steigt der Druck, Performance belastbar zu belegen und in die Wertentwicklung zu übersetzen.
Fachbegriff erklärt: KI im Immobilienkontext
Künstliche Intelligenz im Immobilienbereich umfasst datengetriebene Verfahren für Prognosen, Automatisierung und Entscheidungsunterstützung. Beispiele: Nachfrageprognosen für Vermietung, automatisierte Bonitätschecks, Instandhaltungsprognosen im Objektmanagement, generatives Planen für Flächenlayouts, Portfolio-Optimierung im Asset Management. Der Nutzen liegt in Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kostensenkung. Allerdings gelten Datenschutz, Datenqualität, Revisionssicherheit und Bias-Kontrolle als zentrale Anforderungen. In Europa setzen Unternehmen zunehmend auf KI entlang des gesamten Zyklus, von Akquise bis Exit – die Studie bestätigt den starken Nutzungsanstieg.
Historischer Kontext: Von Globalisierung zu resilienten Märkten
Seit den 1990er-Jahren prägten Globalisierung, fallende Zinsen und offene Kapitalmärkte die Immobilienfinanzierung. Europäische Städte profitierten von grenzüberschreitenden Investments, die Liquidität und Wettbewerb erhöhten. Nach der Finanzkrise 2008 folgte eine Dekade extrem niedriger Zinsen, in der Core-Immobilien zu beliebten Anleihenersatz-Investments wurden. Gleichzeitig professionalisierten sich Nischen: Logistik gewann durch E-Commerce, Wohnen durch Urbanisierung, Hotels durch Tourismus. Seit Mitte der 2010er-Jahre verschoben geopolitische Ereignisse – von Handelskonflikten über Brexit bis zur Pandemie – die Risikowahrnehmung. Lieferketten wurden überprüft, lokale Resilienz zum Leitmotiv. Der Krieg in der Ukraine und Energiepreisrisiken beschleunigten den Fokus auf Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung. 2022/23 stiegen Zinsen rasch, was Bewertungen, Dealstrukturierung und Kreditkosten veränderte. Heute zeigt die Studie, dass strategische Antworten gesucht werden: mehr operative Assets, technologiegestützte Effizienz, ESG mit belastbaren Nachweisen und ein wacher Blick auf Regulierung. Österreichs Markt fügt sich in diese Entwicklung ein, mit einem starken Wohnfokus, kommunaler Tradition und wachsender Bedeutung energetischer Sanierung.
Wien im Ranking: Einordnung und Konsequenzen
Wien fällt im Städte-Attraktivitätsranking von Platz 13 auf 17. Die Studie nennt als Gründe die schwache Wirtschaft mit negativem Ausblick sowie regulatorische Unsicherheiten im Wohnbereich. Für Investorinnen und Investoren heißt das: Projekte werden stärker auf Planungs- und Rechtsrahmen geprüft, und Kapital vergleicht Wien kritischer mit Standorten, die Größe und Liquidität betonen, etwa London, Madrid oder Paris. Gleichzeitig bleibt Wien mit hoher Lebensqualität, starkem Mietermarkt und Infrastruktur solide positioniert – allerdings mit dem Erfordernis, Rahmenbedingungen zu klären, Verfahren zu beschleunigen und Investitionssicherheit zu erhöhen. Für Bauträgerinnen und Bauträger rückt die Machbarkeit in den Vordergrund: Baukosten, Energie, Finanzierung und ESG-Anforderungen müssen in ein dauerhaft tragfähiges Business Case-Modell passen.
Vergleich: Österreichs Bundesländer, Deutschland und Schweiz
Österreich ist traditionell wohnlastig: In Wien prägen Altbau, geförderter Wohnbau und kommunale Bestände den Markt, während in Bundesländern wie Oberösterreich und Steiermark Industrie- und Logistiknähe an Bedeutung gewinnen. Touristische Regionen wie Tirol und Salzburg stehen vor der Aufgabe, Zweitwohnsitze, Betriebsimmobilien und saisonale Nachfrage mit strengen Raumordnungen zu harmonisieren. Kärnten und Vorarlberg punkten mit Grenz- und Innovationsnähe, haben aber begrenzte Flächen. Diese Vielfalt erschwert eine Einheitsstrategie und begünstigt differenzierte, regionale Ansätze.
Deutschland zeigt mit Metropolen wie Berlin, München oder Frankfurt ebenfalls eine Spreizung: Mietrechtliche Eingriffe, die Diskussion um Sanierungsquoten und hohe Baukosten belasten Geschäftsmodelle, während Logistik und Rechenzentren in Korridoren mit guter Netz- und Stromanbindung zulegen. Die Schweiz kombiniert traditionell stabile Rahmenbedingungen mit strikter Flächen- und Baurechtspolitik. Niedrigere Leerstände, hohe Bauqualität und lange Planungshorizonte machen Projekte berechenbar, jedoch anspruchsvoll in der Umsetzung. Im Dreiländervergleich wird deutlich: Wien muss seine Stärken – Lebensqualität, Planbarkeit, Ausbildung – mit schnellerer Verfahrenstiefe, Netzausbau und klarer Wohnregulierung verbinden, um international wieder vorzurücken.
Bürgerinnen und Bürger im Fokus: Konkrete Auswirkungen
Was bedeuten die Trends für Haushalte und Unternehmen in Österreich? Erstens: Leistbarer Wohnraum bleibt knapp. Wenn Baukosten hoch und Finanzierungen strenger werden, verschieben sich Projekte oder sie werden kleiner geplant. Das kann das Angebot im mittleren Preissegment drücken. Kommunale und geförderte Modelle gewinnen daher an Bedeutung, insbesondere in Wien und den Speckgürteln. Zweitens: Energie und Digitalisierung rücken in den Alltag. Gebäude mit guter Dämmung, erneuerbarer Versorgung und smartem Management sparen Betriebskosten – für Mieterinnen und Mieter wie für Eigentümerinnen und Eigentümer. Drittens: KI-gestützte Prozesse verkürzen Vermietungszeiten und erhöhen Servicequalität, etwa durch schnellere Bonitätsprüfungen und transparente Nebenkostenprognosen.
Für kleine und mittlere Unternehmen bedeutet der Trend zu operativen Assets neue Chancen: flexible Flächen, Co-Working in Bezirkslagen, kleine Logistik-Hubs für letzte Meile. Rechenzentrumsnähe kann für Digitalunternehmen ein Standortfaktor sein, vorausgesetzt Netze und Energie sind verfügbar. Gemeinden profitieren, wenn Investitionen in Quartiersenergie, Mobilität und Durchmischung die Lebensqualität steigern. Gleichzeitig verlangt der Wandel aktive Steuerung: klare Bebauungsregeln, zügige Genehmigungen, standardisierte ESG-Nachweise. Bürgerinnen und Bürger merken die Effekte im Alltag dann positiv, wenn Wohnen, Arbeit, Mobilität und Versorgung in einem bezahlbaren, gut vernetzten Umfeld zusammenkommen.
Auswirkungen der Zahlen: Einordnungen ohne Spekulation
Die Verdoppelung der Deglobalisierungssorgen innerhalb von zwei Jahren zeigt, wie stark geopolitische Risiken in Investitionskalkulationen durchschlagen. Der Sprung bei KI-Nutzung von 51 auf 75 Prozent legt nahe, dass Effizienzgewinne und Datenqualität wettbewerbsentscheidend werden. Der Rückgang des ESG-Anteils als Haupttreiber von 40 auf 21 Prozent bedeutet nicht weniger Relevanz, sondern eine Re-Priorisierung: Dekarbonisierung bleibt Kern, wird aber stärker über Wirtschaftlichkeit und Wertentwicklung begründet. Dass Rechenzentren und Energieinfrastruktur vorn liegen, spiegelt die Suche nach resilienten, nachfragestabilen Nutzungen. Für Wien impliziert Platz 17 die Aufgabe, Verfahren zu beschleunigen, regulatorische Klarheit zu schaffen und Wachstumspotenziale – etwa bei Sanierung und Energie – konsequent zu heben.
Perspektiven 2026: Strategien für Standort und Portfolio
Für 2026 zeichnet sich ein pragmatischer Pfad ab: Portfolios werden robuster, nicht riskanter. Das heißt, gemischte Allokationen über Wohnen, Logistiknähe und ausgewählte Infrastruktur-Nutzungen; Sanieren statt nur neu bauen; digitale Tools zur Hebung operativer Erträge. In Wien und den Landeshauptstädten dürften Mixed-Use-Konzepte mit starkem Energie- und Mobilitätsbezug zulegen. Bauträgerinnen und Bauträger werden häufiger Partnerschaften mit Energie- und Netzbetreibern eingehen, um Projekte genehmigungs- und versorgungssicher zu machen. Kapital könnte selektiv zurückkehren, wenn Planungssicherheit wächst, Nebenflächen nutzungsflexibler werden und ESG-Kennzahlen auditierbar sind. Für Haushalte ist entscheidend, dass Förderkulissen Sanierungen ankurbeln und Betriebskosten dämpfen. Gelingt der Schulterschluss zwischen Stadtplanung, Energie und Immobilien, hat Österreich gute Chancen, aus dem globalen Stresstest mit resilienteren, nutzerorientierten Gebäuden hervorzugehen.
Stimmen aus der Quelle
Marius Richter, Real-Estate-Leiter bei PwC Österreich, betont laut Aussendung die gleichzeitige Herausforderung aus Baukosten, Finanzierung und Flächenknappheit – und die Chance auf innovative Entwicklungen wie nachhaltige Projekte und intelligente Mixed-Use-Konzepte. Birgit Kraml, Vorsitzende des Urban Land Institute Österreich, unterstreicht den Trend zu langfristig gedachten Anlagen, die stabile Nachfrage mit gesellschaftlichem Nutzen verbinden. Diese Einordnungen decken sich mit dem Sektorumschwung hin zu infrastrukturähnlichen Assets.
Bei der Präsentation im Wiener DC Tower diskutierten unter anderem Expertinnen und Experten von PwC, DLA Piper, Strabag Real Estate, Etterra, UBM und JP Immobilien über Hürden und Chancen im Jahr 2026. Die fachliche Spannbreite – von Entwicklung über Finanzierung bis Management – spiegelt die Vielschichtigkeit der anstehenden Entscheidungen.
Hinweis zur Methodik und Quellen
Die Ergebnisse basieren auf der Studie ‚Emerging Trends in Real Estate 2026‘ mit 1.276 Befragten aus ganz Europa. Die Kernaussagen, Prozentwerte und Ranglisten stammen aus der Presseinformation von PwC Österreich. Weiterführende Informationen: OTS-Aussendung und vollständige Studie. Diese Analyse erfolgte unabhängig, sachlich und ohne Spekulationen über nicht enthaltene Datensätze.
Fazit: Was jetzt zählt
Die Studie setzt klare Signale: Deglobalisierung verschiebt Kapitalströme, KI und operative Exzellenz werden zum Pflichtprogramm, und ESG bleibt als Dekarbonisierungsauftrag handfest. Für Wien lautet die Hausaufgabe, Verfahren zu beschleunigen, Regulierungsfragen im Wohnbereich verlässlich zu klären und Energie- sowie Digitalinfrastruktur zu stärken. Für Investorinnen und Investoren zahlt sich eine diversifizierte, resiliente Allokation aus; für Bauträgerinnen und Bauträger rücken Sanierung, Quartiersenergie und nutzerzentrierte Mixed-Use-Konzepte in den Vordergrund. Für Haushalte entscheidet die Verbindung aus leistbarem Wohnen, niedrigen Betriebskosten und guter Erreichbarkeit über Lebensqualität.
Wer tiefer einsteigen will, findet die Quellen in der verlinkten OTS-Aussendung und der vollständigen Studie. Teilen Sie uns gerne Ihre Erfahrungen mit Projekten in Wien und den Bundesländern mit: Welche Genehmigungs- und Energiefragen prägen Ihre Vorhaben? Ihre Hinweise helfen, reale Hürden sichtbar zu machen und Lösungen zu bündeln.