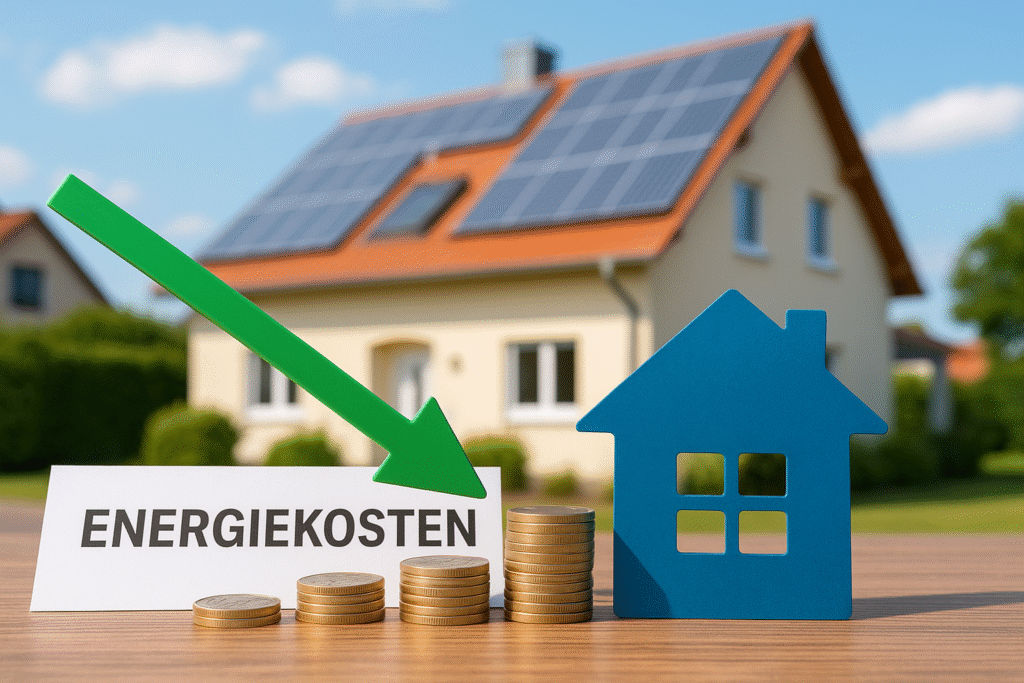Österreich senkt mit dem neuen ElWG die Energiekosten: Was das ab 25.11.2025 für Mieterinnen, Vermieter und Eigentümer bedeutet. Am 25.11.2025 steht die Reform der Elektrizitätswirtschaft im Fokus – und mit ihr die Frage, wie sich niedrigere Energiekosten auf den Wohnungsmarkt auswirken. Der Österreichische Haus- und Grundbesitzerbund (ÖHGB) begrüßt die Richtung: Wenn Strom wieder leistbarer wird, entspannt das die Betriebskosten und damit den Druck bei Mieten und Wohnnebenkosten. Zugleich betont die Debatte in Wien, Linz, Graz und Innsbruck eine österreichweite Relevanz: Energiepreise bestimmen die Haushaltsbudgets ebenso wie die Kalkulation in der Vermietung. Die Regierungsvorlage zum neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) verspricht Anreize zur Netzentlastung und Instrumente zur Dämpfung der Systemkosten. Dieser Beitrag ordnet die Inhalte ein, erklärt zentrale Fachbegriffe laienverständlich und zeigt, welche konkreten Folgen für private Haushalte, Vermieterinnen und Vermieter sowie Bauträger zu erwarten sind. Er basiert auf der aktuellen Meldung des ÖHGB und führt zu weiterführenden Quellen wie Statistik Austria und E-Control. So entsteht ein nüchterner, faktenorientierter Blick auf einen Reformschritt, der in ganz Österreich spürbar werden könnte.
ElWG und Energiekosten: Was Österreich jetzt plant
Der Österreichische Haus- und Grundbesitzerbund hebt in seiner Stellungnahme hervor, dass die Regierungsvorlage im Vergleich zum Ministerialentwurf Verbesserungen enthält. Im Zentrum stehen finanzielle Entlastungen über Netzentlastung, effizientere Strukturen und Dämpfung der Systemkosten. Nach Einschätzung des ÖHGB war der Preissprung im Energiebereich der wesentliche Treiber der Wohnnebenkosten in den vergangenen Jahren. Hauptmietzinse hätten laut ÖHGB unter Berufung auf Statistik Austria im Durchschnitt weniger stark zugelegt als die allgemeine Teuerung, während Betriebskosten – insbesondere Energie, Gebühren und Abgaben – den Ausschlag gaben. Wenn Energie leistbarer wird, reduziert das die Betriebskosten und damit indirekt den Druck am Wohnungsmarkt. Diese Kausalität ist für Haushalte ebenso bedeutsam wie für Eigentümergemeinschaften, Hausverwaltungen und Bauwirtschaft. Das ElWG soll Rahmenbedingungen für ein modernes, kosteneffizientes Stromsystem setzen, das Investitionen, Netzstabilität und faire Tarife besser in Einklang bringt.
Was bedeutet das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG)?
Das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) ist das zentrale Regelwerk für Erzeugung, Transport, Verteilung und Handel von Strom in Österreich. Es legt fest, wie Netzbetreiber planen und abrechnen, welche Rolle Stromhändler spielen, wie Verbraucherinnen und Verbraucher geschützt werden und wie die Aufsicht (etwa durch die Regulierung) funktioniert. Laien können es sich als Verkehrsordnung der Stromwirtschaft vorstellen: Es definiert Fahrbahnen (Netze), Vorfahrtsregeln (Marktregeln), Tempolimits (Sicherheits- und Qualitätsstandards) und Bußgelder (Sanktionsmechanismen). Ein modernes ElWG schafft Anreize für Netzinvestitionen, erlaubt neue Geschäftsmodelle wie Energiegemeinschaften und soll die Kosten der Infrastruktur transparent und fair aufteilen. Ziel ist, Versorgungssicherheit, Klimaziele und Leistbarkeit miteinander zu verbinden.
Netzentlastung: Warum sie die Kosten beeinflussen kann
Netzentlastung beschreibt Maßnahmen, die das Stromnetz vor Überlastung schützen, zum Beispiel indem Verbrauch zeitlich verlagert oder lokal erzeugter Strom vor Ort genutzt wird. Für Laien: Stellen Sie sich das Netz als Wasserleitung vor. Wenn zu viele Haushalte gleichzeitig einen Großverbraucher einschalten, steigt der Druck. Netzentlastung verteilt diesen Druck. Das kann über flexible Tarife, Speicher oder Lastmanagement geschehen. Entlastete Netze benötigen weniger teure Ausbaukapazitäten und weniger Notmaßnahmen, was langfristig Systemkosten senkt. Weniger Systemkosten bedeuten in der Regel weniger Druck auf Netzentgelte, also auf jenen Teil der Energiekosten, der über die Infrastruktur verrechnet wird. Netzentlastung ist deshalb ein Schlüssel, um die Gesamtkosten im Stromsystem zu stabilisieren.
Systemkosten: Der große Kostenblock hinter der Rechnung
Systemkosten sind alle Kosten, die für die sichere Bereitstellung von Strom anfallen, unabhängig davon, wer wie viel verbraucht. Dazu zählen Netzbetrieb, Instandhaltung, Investitionen in Leitungen und Umspannwerke, Ausgleichsenergie zur Stabilisierung der Frequenz sowie IT- und Messinfrastruktur. Für Laien: Neben dem reinen Strompreis zahlen Haushalte auch für die Verfügbarkeit und Sicherheit des Systems – ähnlich wie eine Maut, die Straßenbau und -erhalt finanziert. Steigen Systemkosten, erhöhen sich meist Netzentgelte und andere Preisbestandteile. Politische Anreize, die Netze effizienter auslasten oder kostentreibende Spitzen glätten, können diese Kosten mittelfristig dämpfen. Das ElWG will hier laut ÖHGB mit neuen Instrumenten ansetzen.
Betriebskosten: Mehr als nur Strom
Betriebskosten sind laufende Kosten rund ums Wohnen, die über die Miete hinausgehen. Dazu zählen Energie für Allgemeinflächen, Heizung, Warmwasser, Müllabfuhr, Wasser, Kanal, Hausreinigung, Aufzug, Versicherungen und andere Gebühren. Für Laien: Die Gesamt-Wohnkosten setzen sich aus Miete plus Betriebskosten zusammen. In den vergangenen Jahren stiegen speziell Energie und einige Gebühren dynamisch. Wenn der Strompreis fällt oder Netzentgelte langsamer steigen, wirkt das dämpfend auf Betriebskosten, besonders in Häusern mit vielen elektrischen Verbrauchern (Beleuchtung, Aufzüge, Haustechnik). Diese Entlastung kann sich direkt in den monatlichen Vorschreibungen bemerkbar machen und so Mieterinnen und Mieter ebenso wie Eigentümerinnen und Eigentümer spürbar entlasten.
Valorisierung: Automatische Anpassungen erklärt
Valorisierung bedeutet automatische Anpassung von Entgelten, Gebühren oder Abgaben an einen Index, meist die Inflation. Für Laien: Es ist eine eingebaute Preisgleitklausel, die Zahlungen regelmäßig erhöht, wenn das allgemeine Preisniveau steigt. In der Wohnpraxis betrifft das zum Beispiel bestimmte Gebührenpositionen oder vertraglich geregelte Dienstleistungen. Wenn nun Energiekosten wieder sinken oder sich stabilisieren, kann dies zumindest den dämpfenden Gegeneffekt zu valorisierten Bestandteilen entfalten. Allerdings wirken Valorisierungen träge: Auch wenn einzelne Komponenten fallen, bleiben andere Positionen stabil oder steigen automatisch. Deshalb ist eine dauerhafte Senkung der Energie-bedingten Bestandteile wichtig, um die Gesamtentwicklung abzuflachen.
Hauptmietzins: Der oft missverstandene Posten
Der Hauptmietzins ist die Grundmiete ohne Betriebskosten und Steuern. In der öffentlichen Debatte wird er häufig als alleiniger Preistreiber genannt. Der ÖHGB verweist jedoch, unter Berufung auf Statistik Austria, darauf, dass Hauptmietzinse im Durchschnitt über Jahre weniger stark gestiegen seien als die allgemeine Teuerung. Für Laien: Wenn von steigenden Wohnkosten gesprochen wird, ist oft das Paket aus Miete plus Betriebskosten gemeint – und in diesem Paket trieben Energie, Gebühren und Abgaben zuletzt besonders stark. Eine Senkung der Energiekosten kann daher die Gesamtbelastung reduzieren, selbst wenn der Hauptmietzins stabil bleibt.
Merit-Order: Wie sich der Börsenpreis bildet
Die Merit-Order ist ein Mechanismus am Strommarkt, der bestimmt, welches Kraftwerk den Preis setzt. Kraftwerke werden nach ihren kurzfristigen Kosten aufgereiht, und das teuerste Kraftwerk, das zur Deckung der Nachfrage noch benötigt wird, bestimmt den Preis für alle. Für Laien: Es ist wie eine Auktion, bei der das höchste noch notwendige Gebot den Zuschlagspreis setzt. In Zeiten hoher Gaspreise stieg deshalb der Strombörsenpreis stark. Maßnahmen, die den Bedarf an teuren Spitzenkraftwerken reduzieren (zum Beispiel Netzentlastung, mehr erneuerbare Produktion, Speicher), können die Preisbildung indirekt dämpfen und so langfristig die Energiekosten stabilisieren.
Energiegemeinschaften: Lokal erzeugen, lokal profitieren
Energiegemeinschaften sind Zusammenschlüsse von Haushalten, Unternehmen oder Gemeinden, die gemeinsam erneuerbaren Strom erzeugen, teilen und vor Ort verbrauchen. Für Laien: Nachbarschaften können mit Photovoltaik-Anlagen Strom erzeugen und untereinander nutzen. Das entlastet Netze, verringert Übertragungsverluste und kann Kosten sparen. Ein modernes ElWG kann diese Modelle erleichtern, indem Abrechnung, Messung und Netzentgelte klar geregelt werden. So wird aus passivem Konsum aktives Mitgestalten, was nicht nur die Energiekosten senken, sondern auch die regionale Wertschöpfung stärken kann.
Historische Einordnung: Vom liberalisierten Markt zur Krisenerfahrung
Österreich hat seinen Strommarkt seit der Liberalisierung schrittweise geöffnet und reguliert. In den 2000er-Jahren standen wettbewerbliche Strukturen, Unbundling zwischen Netz und Vertrieb sowie der europäische Marktrahmen im Mittelpunkt. Lange galt Elektrizität als relativ stabil bepreist. Mit dem massiven Preisschock in Europa, der unter anderem durch internationale Gaspreise und geopolitische Verwerfungen ausgelöst wurde, verschoben sich die Prioritäten: Versorgungssicherheit, Resilienz und soziale Abfederung rückten neben den Klimazielen nach vorne. Die Folgen waren in Österreich deutlich spürbar: Stromtarife stiegen zeitweise sprunghaft, Preisbremsen und Ausgleichsmaßnahmen wurden diskutiert und – in Teilen – umgesetzt. In dieser Phase wuchsen die Betriebskosten in vielen Häusern rascher als die Grundmieten. Die politische Lehre: Ein stabiles, kosteneffizientes Stromsystem ist nicht nur Energie- und Industriepolitik, sondern auch Wohn- und Sozialpolitik. Das neue ElWG soll diese Erkenntnis aufgreifen und in regulatorische Leitplanken gießen.
Vergleich: Bundesländer, Deutschland und Schweiz im Blick
Innerhalb Österreichs unterscheiden sich Energiekosten vor allem wegen regionaler Netzstrukturen, Verfügbarkeit erneuerbarer Erzeugung und historischer Tarifmodelle. In städtischen Gebieten mit dichter Infrastruktur sind Skaleneffekte möglich, in alpinen Regionen steigen teilweise Netzaufwendungen pro Kunde. Landesversorger und Stadtwerke setzen unterschiedliche Tarifschwerpunkte, was sich auf Fixkosten und Arbeitspreise auswirkt. Ein modernisiertes ElWG kann durch einheitliche Rahmenbedingungen und Effizienzanreize regionale Unterschiede nicht vollständig nivellieren, aber die Kostentreiber transparenter machen.
Im deutschsprachigen Vergleich zeigen sich strukturelle Parallelen und Unterschiede. Deutschland ringt mit hohen Netzentgelten in Regionen mit viel Erneuerbaren-Zubau und langen Transportwegen; Reformen zielen auf fairere Verteilung der Netzlasten. Die Schweiz verfügt über einen hohen Anteil Wasserkraft und eine spezifische Marktorganisation, in der Haushalte je nach Gemeinde und Versorger unterschiedliche Wahlfreiheiten haben. Für österreichische Haushalte ist wichtig: Alle drei Länder arbeiten an ähnlichen Zielen – Netzstabilität, Kostendämpfung und Integration erneuerbarer Energien. Der konkrete Instrumentenkasten variiert, doch Lehren aus Nachbarländern können helfen, österreichische Lösungen praxistauglich und sozial verträglich zu gestalten.
Was bedeutet das für Bürgerinnen, Vermieter und den Wohnungsmarkt?
Die unmittelbaren Auswirkungen betreffen die monatlichen Vorschreibungen. Sinkt die Stromrechnung für Allgemeinflächen oder für Haushalte, reduziert sich der Betriebskostenanteil. Für eine Familie in Wien-Favoriten, die elektrische Geräte, Beleuchtung und eventuell eine Wärmepumpe nutzt, bedeutet eine Stabilisierung oder Senkung der Energiekosten mehr Planungssicherheit. In einer Eigentümergemeinschaft in Linz können niedrigere Allgemeinstromkosten die Rücklagenbildung entlasten, weil weniger für Betriebsausgaben reserviert werden muss. Hausverwaltungen in Graz profitieren von klareren Regeln bei Messung und Abrechnung, wenn das ElWG Vorgaben für moderne Zähler oder Energiegemeinschaften vereinfacht. In Innsbruck können Vermieterinnen und Vermieter leichter Investitionen in Effizienzmaßnahmen kalkulieren, wenn erwartbare Netzentgelte und Systemkostenpfade mehr Transparenz bieten. Insgesamt gilt: Wird Energie leistbarer, nimmt der Druck am Wohnungsmarkt ab, weil ein großer Kostentreiber entschärft wird. Das hilft nicht nur in Neubauprojekten, sondern gerade im Bestand, wo sanfte Entlastungen im Alltag entscheidend sind.
Gleichzeitig bleibt wichtig: Eine alleinige Fokussierung auf Energiekosten ersetzt nicht die langfristigen Antworten auf Wohnraummangel, Baulandpreise oder Baukosten. Das ElWG adressiert den Energie- und Stromteil der Gleichung. Doch bereits die Entlastung bei Betriebskosten kann für Haushalte mit knappem Budget spürbar sein – egal ob in der Steiermark, in Oberösterreich oder im Burgenland. Wer seine monatlichen Fixkosten reduziert, gewinnt finanziellen Spielraum für Konsum, Bildung oder Rücklagen.
Zahlen und Fakten: Was sich sagen lässt – und was nicht
Der ÖHGB verweist auf Zahlen von Statistik Austria, wonach Hauptmietzinse über Jahre hinweg im Schnitt weniger stark gestiegen seien als die allgemeine Inflationsrate, während Energiekosten und Gebühren die Wohnkosten nach oben getrieben haben. Diese Aussage ordnet plausibel ein, was viele Haushalte in ihrer Vorschreibung sehen: ein kräftiger Anstieg der energiebezogenen Posten. Zugleich gilt im Sinne sorgfältiger Berichterstattung: Genaue Prozentwerte variieren je nach Zeitraum, Region und Tarif. Wer seine individuelle Situation bewerten will, sollte die Auswertungen von Statistik Austria sowie die Tarifinformationen der E-Control konsultieren.
Wesentlich ist der Mechanismus: Steigen Systemkosten und Netzentgelte, erhöht dies den Fixkostenanteil der Stromrechnung, unabhängig vom individuellen Verbrauch. Umgekehrt kann Netzentlastung über flexible Verbraucher, Speicher oder lokale Nutzung von erneuerbarem Strom die Bedarfsspitzen glätten. Dadurch muss das Netz weniger stark und weniger schnell ausgebaut werden, was mittelfristig Kostendruck nimmt. Ergänzend schaffen transparente Regeln für Energiegemeinschaften und Smart Metering eine Grundlage für faire Abrechnung und zielgerichtete Tarife, die Lastverschiebung belohnen, ohne Haushalte zu überfordern. Die Regierungsvorlage hebt laut ÖHGB genau diese Punkte hervor: stärkerer Fokus auf Netzentlastung und zusätzliche Instrumente zur Dämpfung der Systemkosten.
Regierungsvorlage vs. Ministerialentwurf
Nach der ÖHGB-Einschätzung enthält die Regierungsvorlage im Vergleich zum Ministerialentwurf deutliche Verbesserungen. Dazu zählen Anreize, die Netzspitzen reduzieren, sowie Instrumente, die Systemkosten dämpfen sollen. Für Laien bedeutet das: Statt nur auf den Strompreis zu schauen, will der Gesetzgeber an den Stellschrauben ansetzen, die die Infrastrukturkosten treiben. Je besser Spitzen geglättet und lokale Erzeugung genutzt wird, desto geringer fällt langfristig der Bedarf an teuren Reserve- und Ausbaumassnahmen aus. Das entlastet perspektivisch Netzentgelte und damit die Energiekosten der Haushalte – und nimmt Druck vom Wohnungsmarkt.
Zukunftsperspektive: Realistische Entlastung, kein Wundermittel
Wie stark die Energiekosten tatsächlich sinken, hängt von vielen Faktoren ab: internationale Großhandelspreise, inländischer Ausbau der Erneuerbaren, Tempo bei Netzmodernisierung, Akzeptanz flexibler Tarife und technologische Innovationen. Realistisch ist eine schrittweise Entlastung, wenn die Maßnahmen des ElWG zügig umgesetzt werden und Haushalte sowie Betriebe die neuen Möglichkeiten nutzen. Energiegemeinschaften können mehr lokalen Strom bereitstellen, Smart Metering kann Lasten verlagern, und klare Regeln können Investitionen beschleunigen. In Summe ergeben viele kleine Effekte eine spürbare Wirkung.
Für den Wohnungsmarkt bedeutet das: Betriebskosten erhalten einen Dämpfer, die Kalkulierbarkeit steigt. Projektentwicklerinnen und -entwickler können seriöser mit Energieposten kalkulieren, Vermieterinnen und Vermieter können moderate Vorschreibungen besser begründen, und Mieterinnen und Mieter gewinnen Planungssicherheit. Dennoch bleibt es wichtig, ergänzende wohnpolitische Maßnahmen nicht zu vernachlässigen – etwa zur Ausweitung des Angebots, zur Beschleunigung von Verfahren oder zur Förderung leistbaren Bauens. Das ElWG kann den Boden bereiten, auf dem diese Bausteine wirtschaftlich tragfähiger werden.
Quellen, Service und weiterführende Informationen
Primäre Quelle dieser Einordnung ist die aktuelle Stellungnahme des Österreichischen Haus- und Grundbesitzerbundes, abrufbar über die OTS-Presseaussendung: OTS: ÖHGB zu ElWG. Allgemeine Daten zu Preisen und Indizes bietet Statistik Austria. Tarif- und Marktinformationen zum Strom sowie Hinweise zu Netzentgelten und Lieferanten finden sich bei der Regulierungsbehörde E-Control. Diese Links helfen dabei, die eigene Situation zu prüfen und seriöse Entscheidungen zu treffen. Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Rechtsberatung dar, sondern eine sachliche Einordnung auf Basis der vorliegenden Quelle.
Fazit: Entlastung über den Strom – Chance für leistbares Wohnen
Die Kernbotschaft des ÖHGB lautet: Weniger Energiekosten bedeuten weniger Druck auf den Wohnungsmarkt. Das neue ElWG zielt über Netzentlastung und gedämpfte Systemkosten auf genau diese Stellschrauben. Für Österreichs Haushalte und Vermieterinnen wie Vermieter eröffnet das die Aussicht auf stabilere Betriebskosten und bessere Planbarkeit. Historische Erfahrung und Vergleiche mit Deutschland und der Schweiz zeigen: Strukturreformen greifen schrittweise, nicht über Nacht. Wer heute die Rahmenbedingungen verbessert, erntet morgen verlässlichere Preise und robustere Netze.
Bleiben Sie informiert: Prüfen Sie Ihre Tarife, nutzen Sie Beratungsangebote von E-Control, beobachten Sie Entwicklungen bei Statistik Austria und sprechen Sie mit Ihrer Hausverwaltung über Effizienzmaßnahmen. Wie erleben Sie die Entwicklung Ihrer Betriebskosten? Schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen und Fragen – und finden Sie weiterführende Informationen über die verlinkten Quellen. So wird aus einer gesetzlichen Reform ein konkreter Vorteil im Alltag.