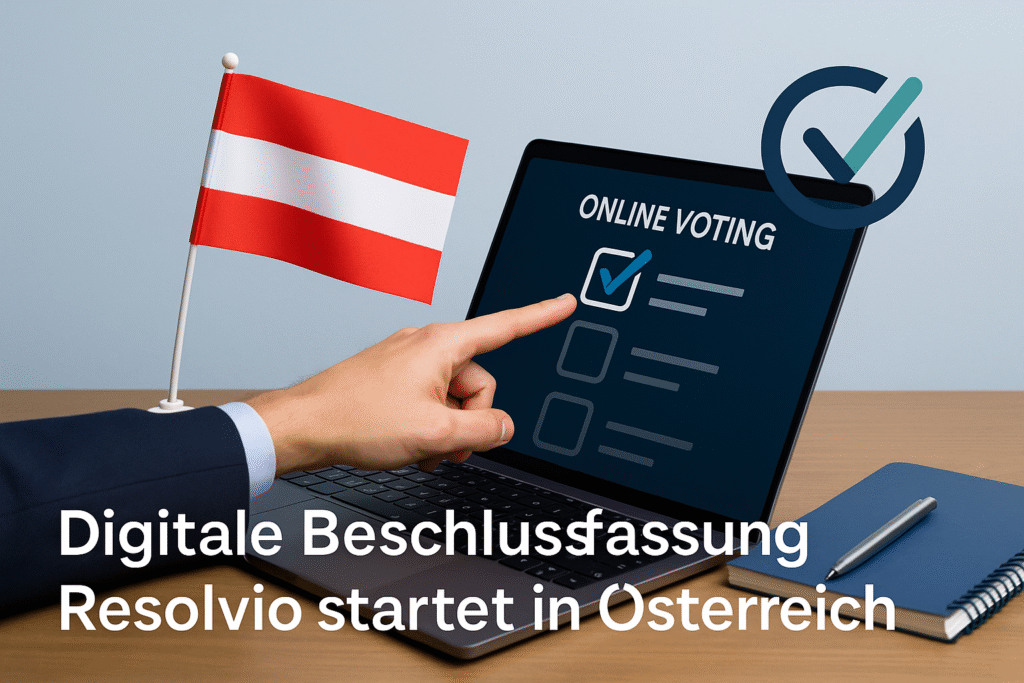Am 19. November 2025 rückt ein Thema in den Fokus, das für Unternehmen, Vereine, Stiftungen und Wohnungseigentümergemeinschaften in ganz Österreich zunehmend entscheidend wird: die digitale Beschlussfassung. Eine neue Plattform der Resolvio GmbH verspricht, Gremienarbeit rechtssicher, effizient und alltagstauglich zu machen. Für Österreicherinnen und Österreicher ist das mehr als ein Tech-Thema, denn rechtssichere Entscheidungen betreffen vom Aufsichtsrat bis zum Beirat und vom Verband bis zur Eigentümerversammlung viele Lebensbereiche. Spannend ist dabei die Kombination aus Rechtskonformität, europäischem Datenschutz und praktischer Anwendung. Die Ankündigung kommt zur rechten Zeit, denn die Digitalisierung von Abstimmungen und Protokollen schreitet seit Jahren voran, doch oft fehlten nachprüfbare Standards und einfache Werkzeuge. Jetzt stellt sich die Frage: Wie gut taugt eine spezialisierte Lösung für die Praxis in Österreich und dem DACH-Raum und was ändert sich konkret im Alltag von Entscheiderinnen und Entscheidern sowie von Verwaltungen und Eigentümergemeinschaften.
Digitale Beschlussfassung rechtssicher umsetzen: Was Resolvio anbietet
Die neue Software von Resolvio setzt auf rechtssichere digitale Beschlussfassung für Gremien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Laut dem Unternehmen wurde die Plattform in enger Zusammenarbeit mit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, Steuerberaterinnen und Steuerberatern sowie Notarinnen und Notaren entwickelt. Das Hosting erfolgt laut Anbieter ausschließlich auf europäischen Servern, konkret bei der Deutschen Telekom. Der Anbieter betont, dass damit ein Zugriff durch US-Behörden, die dem US Cloud Act unterliegen, ausgeschlossen sei. Unterstützt werden gängige Rechtsformen und Organisationsstrukturen, also etwa Kapitalgesellschaften, Verbände, Stiftungen, gemeinnützige Organisationen sowie Eigentümergemeinschaften, die Beschlüsse im Rahmen einer Eigentümerversammlung fassen. Zusätzlich soll die Lösung Umlaufbeschlüsse per Klick ermöglichen, Versammlungen ab Einladungsmanagement begleiten und die Protokollierung rechtskonform dokumentieren. Zwei kostenfreie Beschlüsse pro Jahr können zum Test erstellt werden, ein Demotermin ist über die Website des Unternehmens buchbar. Quelle der Angaben ist die Pressemitteilung der Resolvio GmbH, veröffentlicht über OTS.
Für Leserinnen und Leser in Österreich sind besonders zwei Merkmale relevant: die Einbindung der qualifizierten elektronischen Signatur mit der ID Austria sowie die revisionssichere Ablage der Beschlüsse. Beides adressiert die Frage nach Beweiskraft und Nachvollziehbarkeit, die im Streitfall oder bei internen Prüfungen häufig entscheidend ist. Ergänzend zur Softwarevorschau lohnt daher der Blick auf die Begriffe, den Rechtsrahmen und die konkrete Anwendung.
Fachbegriffe verständlich erklärt
Digitale Beschlussfassung
Unter digitaler Beschlussfassung versteht man den gesamten Prozess, in dem Gremien Entscheidungen nicht mehr analog auf Papier oder ausschließlich in Präsenzsitzungen treffen, sondern online vorbereiten, diskutieren, abstimmen und dokumentieren. Dazu zählen die Einladung, Tagesordnung, Abstimmung, Auszählung und Protokollierung. Entscheidend ist, dass die digitale Abwicklung denselben rechtlichen Anforderungen genügen muss wie die analoge. Das umfasst die Identifikation der Teilnehmenden, die korrekte Feststellung der Beschlussfähigkeit, die Einhaltung von Fristen und die sichere Dokumentation. Eine professionelle Plattform bildet diese Schritte strukturiert ab und sorgt für Nachvollziehbarkeit und Beweisbarkeit.
Umlaufbeschluss
Ein Umlaufbeschluss ist eine Entscheidung, die nicht in einer versammelten Sitzung, sondern im Umlaufverfahren getroffen wird. Das heißt, die Mitglieder eines Gremiums erhalten einen Beschlussvorschlag und geben innerhalb einer gesetzten Frist ihre Stimme ab. Traditionell erfolgte das per E-Mail, Brief oder Excel-Liste, was Fehlerquellen birgt. Digital unterstützt bedeutet: Der Beschluss wird online vorbereitet, die Frist wird gesteuert, die Stimmen werden revisionssicher erfasst und das Ergebnis automatisch festgestellt. Das reduziert Missverständnisse, spart Zeit und schafft Klarheit über Fristwahrung, Stimmanteile und Dokumentation.
Qualifizierte elektronische Signatur QES
Die qualifizierte elektronische Signatur ist die rechtssicherste Form der elektronischen Unterschrift im EU-Recht nach eIDAS. Sie setzt eine eindeutige Identifikation der unterschreibenden Person voraus und nutzt ein qualifiziertes Zertifikat eines vertrauenswürdigen Anbieters. In der Praxis bedeutet das, dass eine digital signierte Erklärung rechtlich weitgehend der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt ist. Für österreichische Anwendungen ist die QES über ID Austria besonders bedeutsam, weil sie die Beweiskraft erhöht. Damit lassen sich Beschlussprotokolle oder Feststellungen fälschungssicher und nachvollziehbar signieren.
ID Austria
Die ID Austria ist die staatliche digitale Identität in Österreich. Sie ermöglicht die sichere Online-Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Unternehmen. In Verbindung mit elektronischen Signaturen kann ID Austria zur Erstellung einer qualifizierten elektronischen Signatur verwendet werden. Das beschleunigt behördliche Prozesse, vereinfacht die sichere Anmeldung bei Services und erhöht die Verlässlichkeit digital unterschriebener Dokumente. Für die digitale Beschlussfassung ist die ID Austria relevant, weil sie Identität und Unterschrift sicher zusammenführt und damit die rechtliche Qualität der Beschlussdokumente stärkt.
DSGVO
Die Datenschutz-Grundverordnung der EU regelt, wie personenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen. Für Plattformen zur digitalen Beschlussfassung ist die DSGVO zentral, weil hierbei sensible Informationen über Gremienmitglieder, Abstimmungsverhalten und Protokolle verarbeitet werden. Entscheidend sind Datensparsamkeit, klare Zwecke, sichere Speicherung und der Nachweis, dass technische und organisatorische Maßnahmen eingehalten werden. Für österreichische Organisationen bedeutet das: Sie brauchen nachvollziehbare Prozesse, klare Rollen sowie Vertragspartner, die standardisierte Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen.
US Cloud Act
Der US Cloud Act ist ein US-Gesetz, das amerikanische Anbieter unter bestimmten Bedingungen verpflichtet, Daten herauszugeben, auch wenn diese außerhalb der USA gespeichert sind. Für europäische Organisationen ist das relevant, weil es zu Konflikten mit europäischem Datenschutzrecht führen kann. Anbieter, die ausschließlich auf europäische Hosting-Strukturen setzen und keine US-Rechtsbindung haben, argumentieren, dass dadurch ein Zugriff nach US-Recht ausgeschlossen ist. Organisationen in Österreich prüfen daher genau, welche Lieferketten und Rechtsprechungen auf ihre Datenverarbeitung Einfluss haben können.
Revisionssicherheit
Revisionssichere Ablage bedeutet, dass Dokumente und Daten so gespeichert werden, dass sie unverändert, nachvollziehbar und auffindbar bleiben. Dazu gehören Protokollierung von Änderungen, klare Versionierung, Zugriffskontrollen und Aufbewahrungsfristen. Im Kontext der digitalen Beschlussfassung ist Revisionssicherheit wichtig, um im Nachhinein belegen zu können, wer wann was beschlossen hat und dass das Ergebnis unverfälscht ist. Das erleichtert interne und externe Prüfungen, reduziert Haftungsrisiken und schafft Vertrauen in die digitale Governance.
Zwei-Faktor-Authentifizierung 2FA
Zwei-Faktor-Authentifizierung ergänzt das klassische Passwort um einen zweiten Faktor, etwa eine App-Bestätigung oder einen SMS-Code. Das erhöht die Sicherheit erheblich, weil ein kompromittiertes Passwort allein nicht mehr genügt, um sich anzumelden. Für digitale Beschlussfassungen ist 2FA ein wichtiger Baustein, um Identitäten zu schützen, Abstimmungen vor Manipulation zu bewahren und sensible Protokolle abzusichern. In Kombination mit rollenbasierten Rechten und sicheren Servern entsteht so ein mehrschichtiges Sicherheitskonzept.
Gremienarbeit
Gremienarbeit umfasst die strukturierte Zusammenarbeit von Aufsichtsräten, Vorständen, Beiräten, Vereinsvorständen, Kuratorien und ähnlichen Organen. Sie ist von Fristen, Zuständigkeiten, Dokumentationspflichten und rechtlichen Standards geprägt. Digital unterstützt bedeutet Gremienarbeit: zentrale Unterlagen, klare Prozesse, automatisierte Einladungen, nachvollziehbare Abstimmungswege und rechtskonforme Protokolle. Dadurch sinkt die Fehleranfälligkeit, und es entsteht Transparenz über Zuständigkeiten und Entscheidungen im gesamten Lebenszyklus eines Beschlusses.
Kapitalgesellschaft
Kapitalgesellschaften wie GmbH und AG sind juristische Personen, bei denen das Kapital im Vordergrund steht und die Haftung grundsätzlich beschränkt ist. Entscheidungen werden nach festgelegten Regeln in Organen getroffen. Für sie ist die digitale Beschlussfassung attraktiv, weil viele Vorgänge wiederkehrend sind, Vertraulichkeit zentral ist und die Nachweisbarkeit von Entscheidungen rechtlich besonders wichtig ist. Eine Lösung, die Fristen, Quoren und Protokolle sauber abbildet, kann Kosten senken und Compliance stärken.
Historische Entwicklung und Rechtsrahmen in Österreich
Die Entwicklung hin zur digitalen Beschlussfassung hat in Österreich mehrere Etappen durchlaufen. Bereits vor der Pandemie gab es Schritte zur elektronischen Kommunikation und Signatur, doch der Durchbruch in der Breite gelang erst, als mit pandemiebedingten Sonderregelungen virtuelle und hybride Versammlungen an Bedeutung gewannen. Viele Organisationen erprobten digitale Formate, und die Akzeptanz wuchs. Parallel reifte das europäische Regelwerk eIDAS, das die rechtliche Einordnung elektronischer Signaturen und Vertrauensdienste harmonisiert. Die ID Austria entwickelte sich zur zentralen digitalen Identität, wodurch Unterschriften und sichere Logins in Verwaltungs- und Privatsektor greifbarer wurden.
Nach der Rücknahme befristeter Sonderregeln blieb die Frage: Welche Elemente digitaler Governance sollen dauerhaft etabliert werden. In mehreren Rechtsbereichen wurden digitale Verfahren präzisiert oder verlängert, teils mit klaren Anforderungen an Identifikation, Beschlussfähigkeit und Dokumentation. Für Vereine und Stiftungen entstanden Leitlinien, wie digitale Sitzungen rechtssicher gestaltet werden können. In der Praxis zeigte sich: Ad hoc Lösungen, etwa per E-Mail oder Messenger, führen oft zu Unklarheiten über Fristen, Stimmberechtigungen und Archivierung. Professionelle Werkzeuge, die den gesamten Prozess abbilden, verringern dieses Risiko und helfen, gesetzliche Vorgaben einzuhalten.
Vor diesem Hintergrund positioniert sich eine spezialisierte Plattform wie Resolvio als Baustein für robuste digitale Prozesse. Österreichische Organisationen erwarten neben Rechtssicherheit vor allem DSGVO-Konformität, Nachvollziehbarkeit und Bedienbarkeit auch für ehrenamtlich Engagierte. Dass eine Lösung europäisch gehostet wird und ID Austria für QES nutzen kann, entspricht genau diesen Erwartungen. Entscheidend bleibt, dass interne Statuten und gesetzliche Rahmenbedingungen eingehalten werden, denn die rechtliche Grundlage für digitale Beschlüsse kann je nach Organisationsform differieren. Eine Software ersetzt daher keine Rechtsberatung, sie macht Regelkonformität aber im Alltag einfacher umsetzbar.
Vergleich: Österreich, Deutschland, Schweiz
Im DACH-Vergleich sind die Grundlagen ähnlich, die Details jedoch unterschiedlich. In Österreich spielt die ID Austria eine zentrale Rolle für Identifikation und Signaturen. EU-weit gilt das eIDAS-Regelwerk, das die Kategorien einfacher, fortgeschrittener und qualifizierter elektronischer Signaturen definiert. Österreichische Organisationen profitieren davon, dass QES eine hohe Beweiskraft entfaltet, wenn die Prozesse sauber umgesetzt werden. Für Eigentümerversammlungen und Vereinsentscheidungen gilt: Maßgeblich sind jeweilige Gesetze und Statuten, die digitale Verfahren zulassen oder regulieren können. Daher empfiehlt sich vor der Einführung stets ein Blick in Satzung und Hausordnung.
In Deutschland werden digitale Beschlussfassungen zunehmend genutzt, insbesondere seit Erfahrungen aus Pandemiezeiten. Dort existieren vergleichbare rechtliche Grundlagen mit eIDAS und der Möglichkeit, Bund ID für Identifikation zu verwenden. Umlaufverfahren werden stark professionalisiert, weil Verfahrensfehler schnell zu Anfechtungen führen können. In der Schweiz gilt ZertES als nationales Regelwerk für elektronische Signaturen, das zur EU Systematik Parallelen aufweist. Schweizer Organisationen legen großen Wert auf Nachweis und Integrität, wodurch revisionssichere Speicherung, klare Protokolle und die Trennung von Rollen wichtig sind. Für Anbieter, die in allen drei Ländern tätig sind, bedeutet das: Prozesse müssen flexibel genug sein, um nationale Besonderheiten abzubilden, während die Grundprinzipien von Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Benutzerfreundlichkeit gleich bleiben.
Konkrete Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger sowie Organisationen
Was ändert sich im Alltag. Für Österreicherinnen und Österreicher, die in Vereinen aktiv sind, können Einladungen, Abstimmungen und Protokolle künftig strukturierter ablaufen. Statt langer E-Mail Ketten erhalten Vorstandsmitglieder eine klare Agenda, stimmen innerhalb einer festgelegten Frist ab und sehen das Ergebnis transparent. Für gemeinnützige Organisationen bedeutet das weniger Verwaltungsaufwand und mehr Zeit für den eigentlichen Zweck. Eigentümergemeinschaften profitieren, wenn Umlaufbeschlüsse sauber dokumentiert sind. Beispiel: Eine dringende Sanierungsentscheidung kann digital vorbereitet, im Rahmen der geltenden Regeln abgestimmt und mit QES signiert werden. Das verringert Konflikte darüber, ob Fristen eingehalten und Stimmen korrekt gezählt wurden.
In Unternehmen reduziert eine digitale Beschlussfassung das Risiko von Verfahrensfehlern im Aufsichtsrat oder Beirat. Rollen und Rechte sind definiert, Einladungen sind revisionssicher versendet, und die Abstimmung erfolgt mit 2FA geschützt. Das erleichtert Audits und interne Kontrollen. Verbände und Stiftungen erhalten eine nachvollziehbare Historie der Entscheidungen, was für Fördergeberinnen und Fördergeber oder Prüfinstanzen ein starkes Signal ist. Wichtig bleibt dabei: Eine Plattform ist nur so gut wie die Prozesse, die sie abbildet. Daher sollten Organisationen ihre Statuten und internen Richtlinien prüfen und gegebenenfalls anpassen, um digitale Verfahren eindeutig zu erlauben und zu standardisieren.
Zahlen, Fakten und Einordnung
Die vorliegende Quelle nennt wenige harte Zahlen. Gesichert ist: Die Resolvio GmbH wurde 2022 gegründet, hat ihren Sitz in Heilbronn und wurde unter anderem durch den Startup Accelerator Campus Founders der Schwarz Gruppe sowie die L Bank gefördert. Die Lösung bietet laut Unternehmen zwei kostenlose Beschlüsse pro Jahr zum Test. Die Speicherung erfolgt nach Angaben des Anbieters DSGVO konform auf Servern der Deutschen Telekom in Europa. Zudem werden Sicherheitsfunktionen wie verschlüsselte Übertragung und Zwei Faktor Authentifizierung betont. Diese Fakten sind der Pressemitteilung entnommen. Weitere Statistiken, etwa zu Nutzerzahlen, Erfolgsquoten, durchschnittlichen Durchlaufzeiten oder Kostenmodellen über den Test hinaus, liegen in der Quelle nicht vor. Daher lassen sie sich hier nicht verlässlich beziffern.
Für österreichische Organisationen ist die Zahlenlage dennoch in einem Punkt klar: Je höher die rechtliche und technische Qualität einer digitalen Beschlussfassung, desto geringer ist das Risiko von Anfechtungen oder Wiederholungen. Das spart indirekt Zeit und Kosten. Zudem schafft die Kombination aus eIDAS kompatibler QES und ID Austria eine belastbare Basis für Beweiskraft. Wer zwei Beschlüsse kostenfrei testet, kann Praxisfragen klären: Passen Fristen, Quoren, Rollen und Workflows zur eigenen Satzung. Wie verständlich ist die Oberfläche für ehrenamtlich Engagierte. Solche Tests sind wertvoll, um vor einer breiten Einführung Akzeptanz aufzubauen.
Expertenstimme aus der Quelle
Der Geschäftsführer der Resolvio GmbH, Hubertus Scherbarth, ist laut Pressemitteilung Rechtsanwalt und Steuerberater. Er hebt hervor, dass jede Funktion gemeinsam mit spezialisierten Juristinnen und Juristen entwickelt wurde, um rechtssichere Beschlussfassung und Dokumentation zu gewährleisten. Gleichzeitig sollen Haftungsrisiken und typische Fehler manueller Abläufe minimiert werden. Aus journalistischer Sicht ist diese Einordnung plausibel: Wenn Prozesse für Einladung, Abstimmung, Feststellung und Protokollierung standardisiert und technisch abgesichert sind, sinkt das Risiko von Versäumnissen. Wichtig bleibt, dass die Plattform die Vielfalt realer Satzungen und Gesetze abbildet und dass Anwenderinnen und Anwender geschult werden.
So läuft eine digitale Versammlung mit Autopilot Ansatz
Die Plattform begleitet laut Anbieter den gesamten Weg von der kollaborativen Vorbereitung über Einladungen bis zur rechtskonformen Protokollierung. In der Praxis könnte das so aussehen: Die Organisatorinnen und Organisatoren erstellen die Tagesordnung, ordnen Beschlussvorlagen zu und definieren Fristen. Die Einladungen werden zentral verschickt und die Teilnahme wird dokumentiert. Während der Sitzung werden Abstimmungen digital durchgeführt, Stimmen gezählt und Ergebnisse festgehalten. Am Ende entsteht ein Protokoll, das mit QES signiert und revisionssicher archiviert wird. Der Nutzen: weniger Medienbrüche, eine einheitliche Datenbasis und klare Verantwortlichkeiten.
Praxisleitfaden: Schritte für österreichische Organisationen
- Statuten und Hausordnungen prüfen: Erlauben sie digitale Sitzungen, Umlaufbeschlüsse und elektronische Signaturen.
- Rollen und Quoren festlegen: Wer ist stimmberechtigt, welche Mehrheit ist erforderlich, welche Fristen gelten.
- Identifikation und Signatur planen: Einsatz von ID Austria und QES definieren, um Beweiskraft zu sichern.
- Datenschutz klären: DSGVO Pflichten, Auftragsverarbeitung und Speicherorte dokumentieren.
- Pilotphase starten: Mit den zwei kostenfreien Beschlüssen Workflows testen und Feedback sammeln.
- Schulung sicherstellen: Anwenderinnen und Anwender in Oberfläche, Fristenmanagement und Protokollablage einführen.
Vertiefende Ratgeber finden Sie hier: ID Austria aktivieren, Eigentümerversammlung digital, DSGVO Ratgeber, E Signatur im Vergleich.
Zukunftsperspektive: Wohin entwickelt sich die digitale Beschlussfassung
Die nächsten Jahre werden von drei Trends geprägt: Erstens die weitere Standardisierung rechtlicher Anforderungen in Europa, getrieben durch die Weiterentwicklung von eIDAS und die Verbreitung staatlicher Identitätslösungen wie ID Austria. Zweitens die Professionalisierung der Gremienarbeit mit integrierten Workflows, die Einladungen, Abstimmungen, Protokolle und Archivierung nahtlos verbinden. Drittens die Stärkung der Beweiskraft durch den breiteren Einsatz der qualifizierten elektronischen Signatur. Für Österreich bedeutet das: Digitale Verfahren werden zum Normalfall, nicht zur Ausnahme. Organisationen, die sich früh auf solide Prozesse und Tools einstellen, reduzieren Reibungsverluste und stärken die Governance.
Zudem gewinnt der Sicherheitsaspekt weiter an Gewicht. Zwei Faktor Verfahren, nachvollziehbare Zugriffsprotokolle und europäisches Hosting bleiben Kernanforderungen. Anbieter, die Transparenz über Lieferketten und Rechtsräume schaffen, werden bevorzugt. Auch die Integration mit Dokumentenmanagement und Kollaborationstools wird wichtiger, damit Beschlüsse nicht isoliert, sondern im Gesamtprozess der Organisation wirken. Für Eigentümergemeinschaften kann dies bedeuten, dass saisonale Entscheidungen schneller getroffen und sauber abgelegt werden. Für Unternehmen bietet es die Chance, Audit Readiness nicht als jährliches Projekt, sondern als fortlaufenden Zustand zu leben.
Rechtlicher Hinweis und Abgrenzung
Die hier dargestellten Informationen basieren auf der Pressemitteilung der Resolvio GmbH, veröffentlicht am 19. November 2025 über OTS. Sie ersetzen keine Rechtsberatung. In Österreich können je nach Rechtsform, Satzung und Materiengesetz unterschiedliche Anforderungen für digitale Beschlüsse gelten. Vor der Einführung digitaler Verfahren sollten Organisationen die Rechtslage prüfen oder fachkundige Beratung einholen. Eine Software kann die Einhaltung erleichtern, die Verantwortung für korrekte Anwendung liegt jedoch beim Gremium.
Fazit und Ausblick
Digitale Beschlussfassung etabliert sich in Österreich als tragfähige Lösung für Gremienarbeit. Die neue Plattform von Resolvio adressiert zentrale Anforderungen: rechtssichere Prozesse, QES über ID Austria, DSGVO konformes Hosting in Europa und revisionssichere Dokumentation. Für Vereine, Stiftungen, Unternehmen und Eigentümergemeinschaften eröffnet das Chancen, Entscheidungen schneller, transparenter und belastbarer zu machen. Gleichzeitig bleibt es wichtig, interne Regeln zu schärfen, Zuständigkeiten klar zu definieren und Teams zu schulen. Wer jetzt die zwei kostenfreien Testbeschlüsse nutzt, kann Hürden identifizieren und Akzeptanz schaffen. So wird aus einem Technikprojekt gelebte Governance.
Wie sehen Ihre Erfahrungen mit digitaler Beschlussfassung aus. Schreiben Sie uns und teilen Sie Best Practices aus Ihrem Verein, Unternehmen oder Ihrer Eigentümergemeinschaft. Weitere Hintergründe finden Sie in unseren Ratgebern zu ID Austria, digitalen Eigentümerversammlungen und Datenschutz. Quelle der Unternehmensangaben: Resolvio GmbH über OTS, vollständige Aussendung: OTS Meldung.