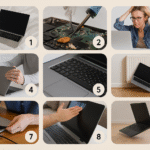Wien (OTS) – Um Bodenschutz und Baubedarf unter einen Hut zu bringen,
braucht es
den konstruktiven Dialog zwischen allen Stakeholdern. Impulse
lieferte das Positionspapier „Österreich ist nicht fertig gebaut!“,
in dem die Baustoffindustrie Perspektiven für eine nachhaltige
Zukunft aufzeigt, sowohl bauwirtschaftlich wie auch bei der
Inanspruchnahme von Flächen.
Die Herausforderungen sind klar: Die Flächeninanspruchnahme hat
bereits ein kritisches Ausmaß erreicht und muss gebremst werden.
Andererseits ist vor allem der Bedarf an neuen Wohnungen enorm,
allein in Wien braucht es rund 15.000 Wohneinheiten zusätzlich pro
Jahr.
Zwtl.: Boden für Siedlungsraum ist knapp
„Österreich wächst und braucht leistbaren Wohnraum und eine
leistungsfähige Infrastruktur machte Andreas Pfeiler, Geschäftsführer
des Fachverbands Steine-Keramik deutlich. Doch Boden sei knapp,
potenzieller Siedlungsraum nur beschränkt verfügbar. Entscheidend
sei, Bauflächen künftig klug und sparsam zu nützen. „Die
österreichische Baustoffindustrie sieht sich hier mit in der
Verantwortung und sucht den Dialog mit den Stakeholdern, um gemeinsam
tragfähige Lösungen zu finden, wie Bodennutzung nachhaltig
funktionieren kann“, betonte Pfeiler.
Zwtl.: Optimale Flächennutzung benötigt strategisches
Flächenmanagement
Boden ist Träger vielfältiger Funktionen und Interessen. „Um hier
die notwendige Balance zu finden, braucht es strategisches
Flächenmanagement mit klaren Zielen“, erklärte Arthur Kanonier,
Forschungsbereichsleiter Bodenpolitik und Bodenmanagement an der
Technischen Universität Wien . Rund 6.000 km² der heimischen Fläche
sind bereits in Anspruch genommen, rund die Hälfte davon als
Baufläche gewidmet, ein Viertel davon noch unbebaut. Mit dem
Bevölkerungswachstum steige auch der Druck auf die verfügbaren
Flächen. „Nicht zersiedeln, sondern in bereits bebauten Flächen
verdichten, ist das Gebot der Stunde“, appellierte Kanonier.
Zwtl.: Bauen ohne Boden: 200.000 Wohnungen auf Wiens Dachflächen
möglich
Aufstockung und Verdichtung, sind die Expertise von Armin Mohsen
Daneshgar, Daneshgar Architects . „Wiens Dächer bieten rund 3 Mio. m²
Fläche für 200.000 Wohnungen“, so Daneshgar. Zumindest ein Stockwerk
könne aufgebaut werden, meist aber mehrere, ohne die Wohnqualität der
unteren Stockwerke zu beeinträchtigen. Weitere positive Effekte:
Dachgärten als grüne Oasen und bis zu 80 Prozent Energieersparnis,
wenn im Zuge der Aufstockung auch der Bestand saniert wird. Freilich
ist auch bei Erweiterungsbauten das Stadtbild zu wahren und auf einen
stimmigen Dialog zwischen alt und neu zu achten, ergänzte Irene
Lundström, Fachbereichsleiterin Stadtbildbegutachtung MA19,
Architektur und Stadtgestaltung der Stadt Wien.
Zwtl.: Sanierung und neue Nutzungen von Bestand
„Neubau ja, doch nachhaltig“, fasste Roland Hebbel,
Obmannstellvertreter Zentralverband industrieller
Bauprodukthersteller, die Situation zusammen, und erklärte:
„Natürlich haben wir Interesse daran, dass gebaut wird. Aber wir
wollen dabei verantwortungsvoll agieren und dazu bekennen wir uns“.
Daniel Fügenschuh, Präsident der Bundeskammer für
Ziviltechniker:innen , pflichtete dem bei: „Wir verbrauchen jedes
Jahr eine Fläche, so groß wie Eisenstadt. Das erhöht die Gefahr von
Hochwasser, Hitzeinseln und anderen Katastrophen. In der Fläche ist
Österreich daher bereits fertig bebaut. Gleichzeitig müssen wir
bereits bebaute Flächen weiternutzen: Durch Wiederbelebung unserer
Ortskerne, Sanierung der Gebäudebestände und Mobilisierung von
Brachen können wir sehr gut weiteren Raum schaffen, ohne Boden zu
verbrauchen.“ Dazu brauche es qualifiziertes Know-How in der Planung.
Zwtl.: Zum Bodensparen braucht es breite Unterstützung
Die österreichische Bodenstrategie hat zum Ziel, die
Flächeninanspruchnahme bis 2030 substanziell zu verringern. Zum Bauen
ohne Boden definiert das aktuelle Regierungsprogramm verschiedene
Ansatzpunkte, wie Vorrang von Flächenrecycling vor Neuwidmung, und
von Sanierung vor Neuerrichtung. Die Entscheidungen sollen stärker
auf Landesebene gebündelt werden. Noch ist abzuwarten, wie sich die
Regierungspläne zu Planungs- und Widmungskompetenzen in der Realität
manifestieren sollen. „Gerade bei Themen wie der Stärkung der
Ortskerne, Leerständen und Bebauungsdichte, braucht es die lokale
Kompetenz“, stellte Johannes Pressl, Präsident des Österreichischen
Gemeindebunds ,im Vorfeld der Veranstaltung fest. Bodensparen sei ein
Anliegen der gesamten Gesellschaft, „auch die heutige Diskussion
zentraler Stakeholder deutet in Richtung einer breiten
Unterstützung“, gab sich Pressl erfreut.
Zwtl.: Baulandmobilisierung: Klarer Rechtsrahmen notwendig
„Wir sehen uns in unseren Bestrebungen der letzten Jahre
bestätigt“, freute sich Pfeiler. Maßnahmen wie verdichtetes Bauen
forciere der Fachverband seit Jahren, „weil so auch Energie gespart
wird.“ Dazu komme, dass mineralische Baustoffe nachhaltig,
kreislauffähig und multifunktional sind und das Bauen in größere
Höhen und in höherer Dichte ermöglichen. „So kann
Baulandmobilisierung umgesetzt und die Bodeninanspruchnahme minimiert
werden“, bekräftigte Hebbel abschließend und forderte dafür
entsprechende und klare gesetzliche Rahmenbedingungen.