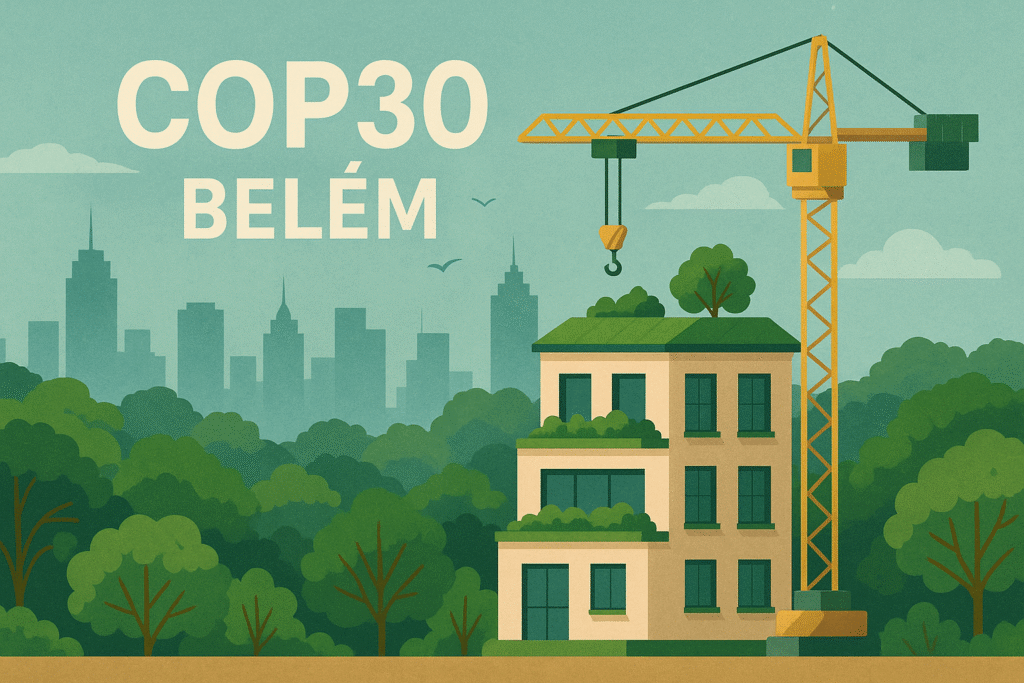Österreichs KRAISBAU schafft es bei COP30 in Belém in den globalen Lösungskatalog für die Bauwende und zeigt, wie KI zirkuläres Bauen beschleunigt. Am 13. November 2025 rückt ein Projekt aus Österreich in den Fokus der internationalen Klimapolitik. Im Buildings and Cooling Pavilion der COP30 in Belém wird der Catalogue of Climate Solutions for Buildings präsentiert, ein Überblick über 90 Praxisbeispiele aus mehr als 40 Ländern und sechs Kontinenten. Mitten drin: das BMIMI-Leitprojekt KRAISBAU. Das Vorhaben steht exemplarisch dafür, wie digitale Methoden, öffentlich verfügbare Daten und künstliche Intelligenz gemeinsam den Übergang zu einem ressourcenschonenden, zirkulären Bauwesen ermöglichen. Für die heimische Bau- und Immobilienwirtschaft ist das mehr als eine symbolische Anerkennung. Es ist ein Signal, dass Lösungen Made in Austria international Beachtung finden und konkrete Wirkung entfalten können – von der Planung über den Umbau bis zum zirkulären Rückbau von Gebäuden.
Bauwende bei COP30: Was KRAISBAU international sichtbar macht
Der Catalogue of Climate Solutions for Buildings versammelt 90 Projekte, die zeigen, wie Klimaschutz im Gebäudesektor praktisch umgesetzt werden kann. Das österreichische Leitprojekt KRAISBAU ist Teil dieser Auswahl. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von KI, die Verknüpfung von Messmethoden und digitalen Modellen sowie die systematische Nutzung öffentlich zugänglicher Daten. Ziel ist es, Planungen für Umbau, zirkulären Rückbau und Neubau zu vereinfachen und zu beschleunigen und damit Kosten, Materialeinsatz und Emissionen zu senken. Das Projekt setzt damit an einem zentralen Hebel an: Der Bauwende.
Für die österreichische Leserschaft ist der Lokalbezug klar: KRAISBAU wird über die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) zu 80 Prozent vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) finanziert, die restlichen 20 Prozent tragen die 32 Konsortialpartner selbst. Getestet wird an realen Demo-Gebäuden in ganz Österreich – vom Umbau großer Industrieruinen über die Umnutzung alter Bauernhäuser bis hin zu Rück- und Neubau von Wohngebäuden. Die Ergebnisse sollen als Factsheets, Train-the-Trainer-Programme und weitere Formate öffentlich zugänglich gemacht werden.
Wer tiefer einsteigen möchte, findet thematische Hintergründe in unseren Dossiers zu zirkulärem Bauen und Klimaschutz im Gebäudebestand: Kreislaufwirtschaft im Bau, Klimaschutz im Gebäude und KI im Bauwesen.
Was im globalen Katalog steht
Der Catalogue of Climate Solutions for Buildings zeigt gebündelt, was sonst oft verstreut bleibt: anwendbare Lösungen, die bereits im Einsatz sind. 90 Projekte aus über 40 Ländern dokumentieren, dass die Bauwende nicht nur eine Vision ist, sondern vielerorts Realität wird. KRAISBAU ergänzt diese Sammlung um eine österreichische Perspektive: Wie lässt sich mit digitalen Werkzeugen die Komplexität des Bauens im Kreislauf bewältigen? Welche Daten braucht es, um Materialien zu identifizieren, ihren Wiedereinsatz zu planen und Kosten realistisch zu beziffern? Und wie kann die Planung so beschleunigt werden, dass Vorhaben wirtschaftlich attraktiv und gleichzeitig ressourcenschonend bleiben?
Fachbegriffe einfach erklärt
- Kreislaufwirtschaft im Bau: Kreislaufwirtschaft bedeutet, Materialien möglichst lange im Umlauf zu halten, anstatt sie nach einmaligem Gebrauch zu deponieren oder zu verbrennen. Im Bauwesen umfasst das den Erhalt von Gebäuden, die Wiederverwendung von Bauteilen, die hochwertige Verwertung von Materialien und die Planung für den späteren Rückbau bereits in der Entwurfsphase. Der Ansatz reduziert Primärrohstoffbedarf, senkt Abfallmengen und vermeidet Emissionen, die bei der Herstellung neuer Baustoffe entstehen. Wichtig ist die Dokumentation der Materialqualität und -menge, damit Bauteile gezielt wieder eingesetzt werden können.
- Lebenszyklus von Gebäuden: Der Lebenszyklus beschreibt alle Phasen eines Gebäudes – von der Rohstoffgewinnung über Produktion, Transport und Bau bis zu Nutzung, Sanierung, Rückbau und Wiederverwendung. Jede Phase verursacht Umweltwirkungen und Kosten. Wer lebenszyklusorientiert plant, betrachtet nicht nur die Baukosten, sondern auch Betriebsenergie, Instandhaltung, Umbaufähigkeit und den Wert der verbauten Materialien am Ende der Nutzung. So können Entscheidungen getroffen werden, die über Jahrzehnte vorteilhaft sind, etwa durch den Einsatz langlebiger, reparierbarer Bauteile oder durch modulare Konstruktionen.
- Zirkulärer Rückbau: Beim zirkulären Rückbau wird ein Gebäude nicht einfach abgerissen, sondern selektiv und sortenrein demontiert. Bauteile und Materialien werden identifiziert, dokumentiert, geprüft und für die Wiederverwendung oder hochwertige Verwertung vorbereitet. Das erfordert genaue Bestandsaufnahmen, logistische Planung und Qualitätsmanagement. Der Vorteil: Wertvolle Ressourcen bleiben erhalten, Materialkosten sinken und es entstehen regionale Märkte für gebrauchte Bauteile. Zirkulärer Rückbau ist damit ein Schlüssel, um die Bauwende vom Ende her zu denken.
- Künstliche Intelligenz im Bauwesen: Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet Verfahren, die aus Daten Muster erkennen, Vorhersagen treffen oder Entscheidungen unterstützen. Im Baukontext kann KI Bestandsdaten aus Sensorik, Scans und Dokumenten zusammenführen, schnelle Analysen zur Gebäudestruktur liefern und Materialpässe aufbereiten. Sie hilft auch, Varianten zu vergleichen, Risiken abzuschätzen und Abläufe zu optimieren. Entscheidend ist die Qualität der Daten und transparente Anwendung: KI unterstützt Fachleute, ersetzt sie aber nicht. Richtig eingesetzt, verkürzt KI Planungszeiten und macht zirkuläre Lösungen wirtschaftlich attraktiver.
- Urban Mining und Urban Minerinnen und Urban Miner: Urban Mining meint das systematische Erschließen der gebauten Umwelt als Rohstofflager. Statt Primärrohstoffe in Minen zu fördern, werden Materialien aus Gebäuden, Infrastrukturen und Produkten zurückgewonnen. Urban Minerinnen und Urban Miner identifizieren, bewerten und heben diese „urbanen Lagerstätten“. Im Bau bedeutet das, Bauteile rechtzeitig vor einem Rückbau zu erfassen, ihre Qualität zu prüfen und Kreisläufe zu organisieren. Das schafft neue regionale Wertschöpfung, senkt Umweltbelastungen und kann Beschäftigungsperspektiven für Menschen mit unterschiedlichem Bildungsniveau eröffnen.
- Digitale Gebäudemodelle: Unter digitalen Gebäudemodellen versteht man strukturierte, oft dreidimensionale Datenmodelle, in denen Bauteile, Materialien und Eigenschaften abgebildet sind. Sie erleichtern die Planung, die Koordination zwischen Gewerken und die Dokumentation für Umbau und Rückbau. Werden solche Modelle mit Messdaten und Bestandsinformationen verknüpft, entsteht ein Datenfundament, auf dem KI wirksam arbeiten kann. Digitale Modelle sind damit eine Brücke zwischen physischem Bauwerk und datengetriebener Bauwende.
Historischer Kontext: Von der Linearkultur zur Bauwende
Über Jahrzehnte war Bauen in Europa von linearen Abläufen geprägt: Materialgewinnung, Herstellung, Nutzung, Abriss, Entsorgung. Der Fokus lag auf Geschwindigkeit, Kosteneffizienz und Flächenausweitung. Externe Effekte – Ressourcenverbrauch, Abfallmengen, graue Emissionen – spielten in der Praxis oft eine Nebenrolle. Erst mit wachsendem Bewusstsein für Klimaschutz und Ressourcensicherung rückte der Gebäudesektor stärker ins Zentrum politischer und wirtschaftlicher Strategien. In Österreich wurde parallel zur energetischen Sanierung die Frage drängender, was mit Bauteilen und Materialien am Ende der Nutzung geschieht und wie Planen und Bauen so gedacht werden kann, dass Rückbau nicht Verlust, sondern Wertschöpfung bedeutet.
Die Bauwende knüpft an diese Entwicklung an und verbindet sie mit digitalen Werkzeugen. Öffentliche Daten, moderne Messtechniken und KI eröffnen neue Möglichkeiten: Bestände lassen sich effizienter erfassen, Materialströme vorhersagen, Rückbaukonzepte simulieren und Kosten zeitnah bewerten. Das BMIMI-Leitprojekt KRAISBAU steht exemplarisch für diesen Übergang. Es testet, wie die Komplexität zirkulärer Prozesse beherrschbar wird, wenn Daten strukturiert zusammenfließen. Zudem zeigt es, dass eine breite Allianz aus Universitäten, IT- und KI-Anbietern, Standortagenturen, Architekturbüros, Baustoffherstellern und Beratungen notwendig ist, um alle Lebensphasen von Gebäuden praxisnah abzubilden.
Praxis statt Theorie: Österreichische Demo-Gebäude als Testfeld
Ob Konzepte tragfähig sind, entscheidet sich in der Anwendung. Genau hier setzt KRAISBAU an: Die Methoden werden an unterschiedlichen Demo-Gebäuden in Österreich erprobt – von der großen Industrieruine über das umgenutzte Bauernhaus bis zum Wohnbau, der rück- und neugebaut wird. Die Vielfalt der Fälle erlaubt, Abläufe zu vergleichen, wiederverwendbare Bauteile zu identifizieren und Datenstandards zu testen. Das hilft, die Bauwende aus der Forschung in die regionale Wertschöpfung zu holen und Erfahrungen breit zu teilen.
Vergleich: Bundesländer und Nachbarländer
Innerhalb Österreichs unterscheiden sich Ausgangslagen und Schwerpunkte. In urbanen Räumen mit hohem Sanierungsdruck ist die Datenerfassung komplexer, dafür sind Skaleneffekte größer. In ländlichen Regionen mit kleinteiligem Bestand stehen Umnutzung und bauliche Erneuerung im Fokus, oft mit starken regionalen Wertschöpfungsketten. Projekte wie KRAISBAU können hier Brücken schlagen, indem sie Daten und Methoden bereitstellen, die in beiden Kontexten funktionieren. Wichtig ist die Übertragbarkeit: Standards, die in einer Industrieruine funktionieren, sollen auch im Wohnbau anwendbar sein.
Ein Blick nach Deutschland zeigt, dass die Diskussion um zirkuläres Bauen ebenfalls an Fahrt aufgenommen hat. Dort liegt der Schwerpunkt häufig auf Normung, Rückbaukonzepten und Marktplätzen für gebrauchte Bauteile. In der Schweiz wird stark auf Qualität, Langlebigkeit und Planungstiefe gesetzt, was zirkuläre Lösungen unterstützt. Österreich kann in diesem Umfeld mit einer pragmatischen Kombination punkten: dezentrale Pilotierung, starke Forschung und eine enge Verknüpfung mit der Praxis. Dass KRAISBAU in den globalen Katalog aufgenommen wurde, unterstreicht diese Position und zeigt, dass die österreichische Bauwende international anschlussfähig ist.
Bürgerinnen und Bürger: Konkrete Auswirkungen im Alltag
Was bedeutet die Bauwende für Eigentümerinnen und Eigentümer, Mieterinnen und Mieter, Betriebe und Gemeinden? Erstens: schnellere, fundiertere Entscheidungen. Wenn Bestandsdaten – etwa zu Material, Statik oder Schadstoffen – digital vorliegen und mit KI ausgewertet werden, lassen sich Umbauvarianten präziser vergleichen. Das reduziert Planungsrisiken und hilft, Budgets einzuhalten. Zweitens: geringere Materialkosten, wo Wiederverwendung möglich ist. KRAISBAU nennt ein Potential von 25 bis 35 Prozent bei den Materialkosten durch Re-Use. Das ist kein Automatismus, zeigt aber die Größenordnung, die durch systematisches Urban Mining, sortenreinen Rückbau und smarte Planung erreichbar ist.
Drittens: neue berufliche Chancen. Zirkuläres Bauen erzeugt Nachfrage nach Qualifikationen, die bisher selten waren – von der Erfassung und Bewertung von Bauteilen über die Demontage bis zu Logistik und Qualitätssicherung. Das eröffnet Beschäftigung für Menschen mit unterschiedlicher formaler Bildung, etwa als Urban Minerinnen und Urban Miner, Materialprüferinnen und Materialprüfer oder Demontagespezialistinnen und Demontagespezialisten. Viertens: regionale Wertschöpfung. Wenn Bauteile lokal wieder eingesetzt werden, bleiben Ausgaben in der Region. Gemeinden profitieren von geringeren Abfallmengen und einem bewussteren Umgang mit dem Gebäudebestand.
Für Konsumentinnen und Konsumenten heißt das: Mehr Transparenz, mehr Auswahl und potenziell geringere Lebenszykluskosten. Wer umbaut, kann früher und fundierter entscheiden, ob Erhalt, Umnutzung oder Ersatzbau die beste Option ist. Und wer neu baut, kann so planen, dass spätere Anpassungen ohne teure Eingriffe möglich sind. Die Bauwende ist damit keine abstrakte Strategie, sondern wirkt in ganz konkreten Projekten – vom Einfamilienhaus bis zur Fabrikhalle.
Zahlen und Fakten: Einordnen, was bekannt ist
- 90 Projekte: Der globale Katalog bündelt vielfältige Ansätze. Die Zahl zeigt, dass erprobte Lösungen vorhanden sind – wichtig für Skalierung.
- Über 40 Länder, 6 Kontinente: Bauwende ist ein weltweites Thema. Österreich mischt in einem internationalen Umfeld mit.
- 32 Konsortialpartner: Die Breite des KRAISBAU-Konsortiums – Universitäten, IT- und KI-Anbieter, Standortagenturen, Architekturbüros, Baustoffhersteller, Steuerberatung – bildet den gesamten Gebäudelebenszyklus ab.
- 80 Prozent Förderung durch BMIMI via FFG, 20 Prozent Eigenmittel: Die Finanzierung ermöglicht große Pilotierungen und breite Wissensvermittlung.
- 25 bis 35 Prozent Materialkosten-Potential: Wiederverwendung kann spürbar Kosten senken, wenn Qualität, Logistik und Planung stimmen.
Diese Kennzahlen lassen sich wie folgt einordnen: 90 Projekte sind ausreichend, um Muster zu erkennen, aber nicht so viele, dass die Übersicht verloren geht. Für Österreich ist die Präsenz im Katalog ein Multiplikator, weil internationale Aufmerksamkeit die Chancen auf Kooperationen erhöht. Die 32 Partner zeigen, dass Bauwende Teamleistung ist. Erst wenn Planung, Materialkunde, Digitalisierung, Ausführung und Wirtschaftlichkeit zusammenspielen, werden zirkuläre Konzepte alltagstauglich. Die Förderstruktur signalisiert politischen Willen und erlaubt, Methoden an unterschiedlichen Gebäudetypen zu testen. Besonders wichtig ist der Materialkosten-Hinweis: 25 bis 35 Prozent machen den Unterschied zwischen guter Idee und wirtschaftlich tragfähigem Geschäftsfall. Diese Spanne ist kein Versprechen, aber ein realistischer Zielkorridor, wenn Wiederverwendung systematisch geplant wird.
Stimmen aus dem Projekt
Projekt-Koordinatorin Anna-Vera Deinhammer beschreibt die internationale Bühne so: „Ich bin nach wie vor sprachlos und zugleich überglücklich, dass unser Projekt aus dem kleinen Österreich hier auf dieser internationalen Bühne vorgestellt wird. In Europa war das Interesse auch bisher schon groß, aber hier schaut wirklich die ganze Welt zu.“
Auch Innovationsminister Peter Hanke betont die Signalwirkung: „Die Aufnahme des BMIMI-Leitprojekts KRAISBAU in den Catalogue of Climate Solutions for Buildings ist ein großer internationaler Erfolg und erneut ein Beweis für die hohe Innovationskraft Österreichs. Der Einsatz von AI-Tools für eine verstärkte Transformation in Richtung Kreislaufwirtschaft und entlang des Lebenszyklus von Gebäuden ist nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Bau- und Ressourcenwende in Österreich, sondern inspiriert jetzt auch Nachahmer auf der ganzen Welt.“
Wie KI zum Gamechanger wird
Der Mehrwert von KI liegt in der Geschwindigkeit und in der Fähigkeit, Komplexität zu strukturieren. Wenn Messdaten, Pläne, Gutachten und öffentlich verfügbare Informationen zusammenkommen, können digitale Modelle nahezu in Echtzeit Aussagen über Materialmengen, Bauteilqualitäten oder Eingriffsfolgen liefern. Das senkt Planungsaufwände und hilft, Varianten zu priorisieren. KI unterstützt auch bei der Steuerung zirkulärer Materialströme: Welche Bauteile sind wo in welcher Qualität verfügbar? Wie lassen sie sich mit möglichst wenig Transportaufwand in einem laufenden Projekt einsetzen? Und welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind zu beachten? All das führt dazu, dass zirkuläre Strategien nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch Sinn ergeben.
Praxisnutzen in Österreich
Konkrete Anwendungen reichen von der automatisierten Materialinventur in Bestandsgebäuden über Prognosen zu Rückbaumengen bis zur Unterstützung bei Ausschreibungen, die Re-Use-Bauteile berücksichtigen. Für öffentliche und private Bauherrinnen und Bauherren entsteht so eine Entscheidungsgrundlage, die Risiken reduziert und Chancen erhöht. Planerinnen und Planer profitieren von schnelleren Abgleichen, Unternehmen von besser planbaren Lieferketten, Gemeinden von geringeren Abfallmengen.
Zukunftsperspektive: Was als Nächstes ansteht
Die Aufnahme in den globalen Katalog ist ein Meilenstein, aber erst der Anfang. In den kommenden Jahren dürfte entscheidend sein, wie sich Standards, Datenqualität und Kompetenzen verbreiten. Je mehr Projekte ihre Materialdaten strukturiert erfassen und teilen, desto einfacher wird die Wiederverwendung. Ausbildungswege für Urban Minerinnen und Urban Miner, Demontage-Profis und Datenmanagerinnen und Datenmanager könnten sich rasch etablieren, wenn Nachfrage und klare Qualifikationsprofile zusammenkommen. Für die Industrie eröffnet sich ein Markt für geprüfte Re-Use-Bauteile und Services rund um Rückbau, Qualitätsprüfung und Logistik.
Für Österreich bietet sich die Chance, die Bauwende als Standortvorteil zu nutzen: effiziente Prozesse, regionale Wertschöpfung und sichtbare Pilotprojekte. Erfolgsentscheidend bleibt, dass die erprobten Methoden breit zugänglich sind. KRAISBAU plant hierfür Factsheets, Train-the-Trainer-Programme und weitere Maßnahmen. Wenn öffentliche Auftraggeberinnen und Auftraggeber zirkuläre Kriterien berücksichtigen, könnte die Nachfrage zusätzlich wachsen. Die Bauwende könnte so vom Pionierfeld in den Mainstream wechseln – getragen von praxistauglichen Werkzeugen und belastbaren Zahlen.
Schluss: Ein österreichischer Beitrag mit globaler Strahlkraft
KRAISBAU zeigt, dass die Bauwende keine ferne Vision ist, sondern mit klugen Daten, KI und Praxiswissen heute beginnt. Die Präsenz im Catalogue of Climate Solutions for Buildings bei der COP30 in Belém macht das international sichtbar. Für Österreichs Bau- und Immobilienwirtschaft ist das eine Einladung, die vorhandenen Methoden zu nutzen und weiterzuentwickeln – im Wohnbau, in der Industrie und in der öffentlichen Hand. Wer jetzt auf zirkuläres Bauen setzt, kann Kosten senken, Risiken reduzieren und regionale Wertschöpfung stärken.
Was denken Sie: Welche Hürde bremst die Bauwende in Ihrem Umfeld am stärksten – Datenqualität, Standardisierung oder die Frage der Wirtschaftlichkeit? Schreiben Sie uns und teilen Sie Erfahrungen aus Praxisprojekten. Weiterführende Informationen und die originale Pressemitteilung finden Sie hier: Quelle: KRAISBAU via OTS. Mehr Hintergründe in unseren Dossiers: Kreislaufwirtschaft im Bau, Klimaschutz im Gebäude, KI im Bauwesen.
Hinweis: Dieser Beitrag basiert auf der genannten Quelle und hält sich an die Richtlinien des österreichischen Presserats. Alle Zahlen und Zitate stammen aus der verlinkten Pressemitteilung.